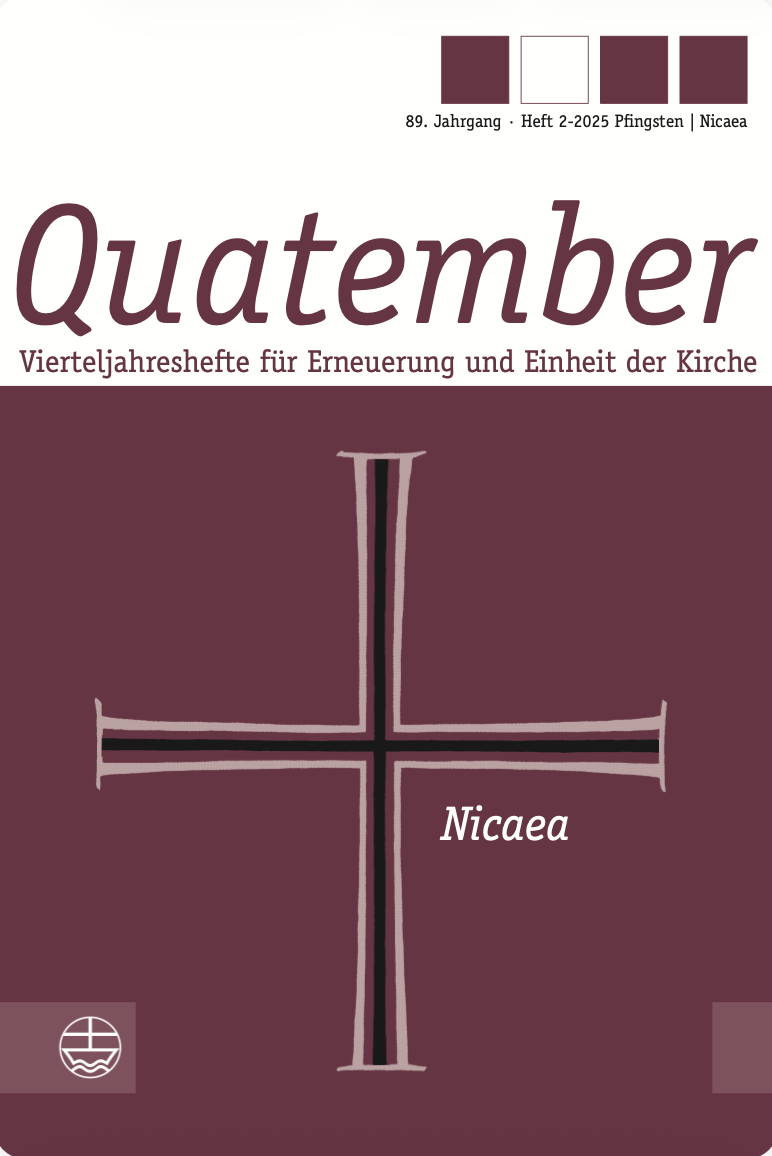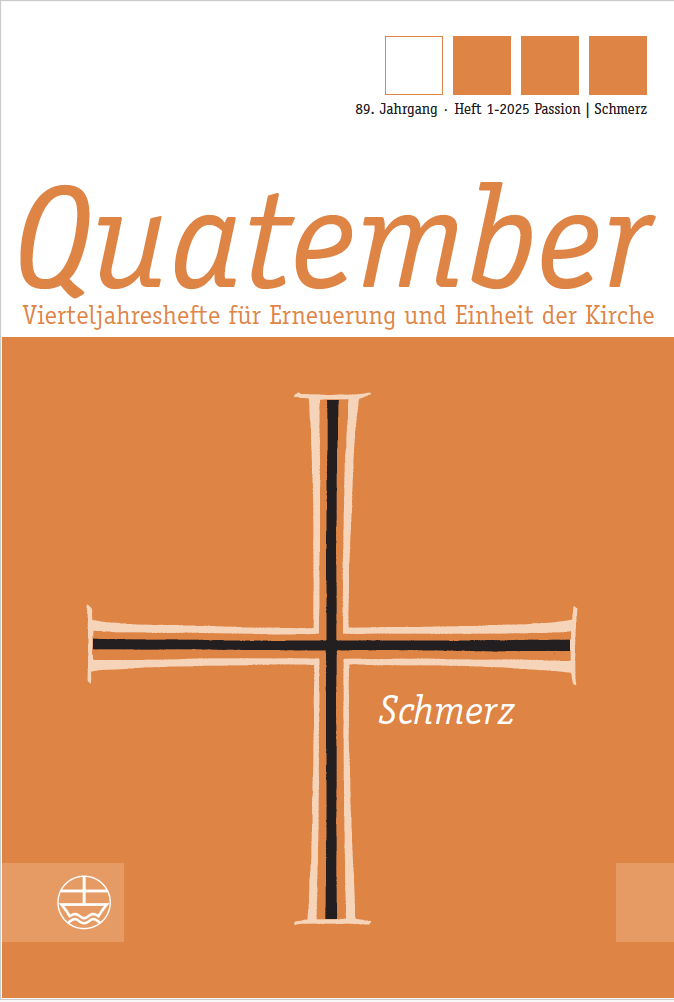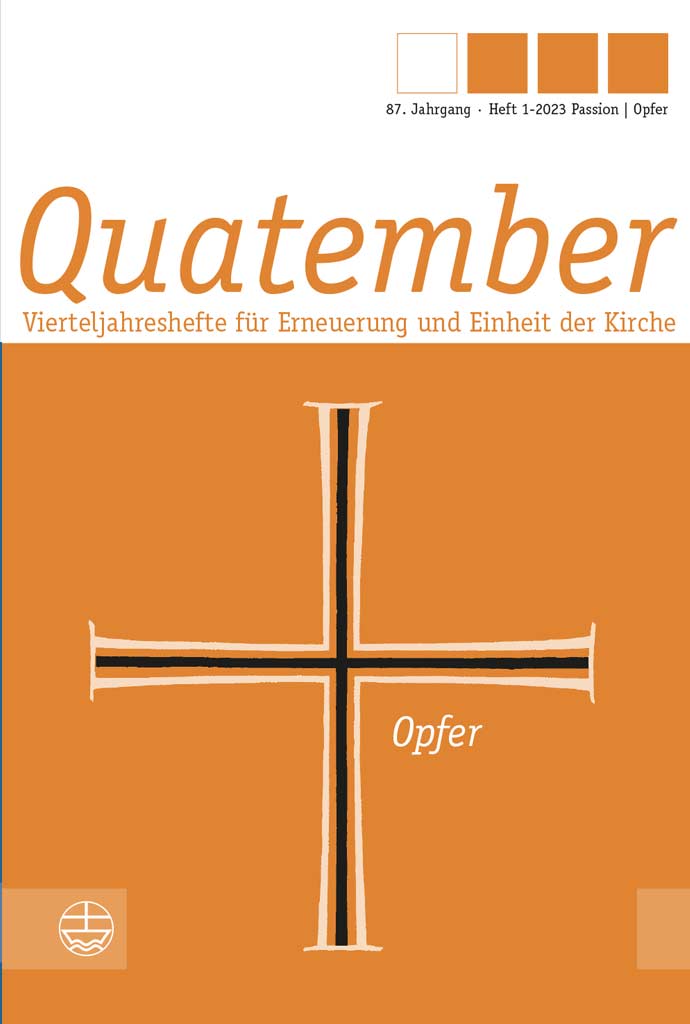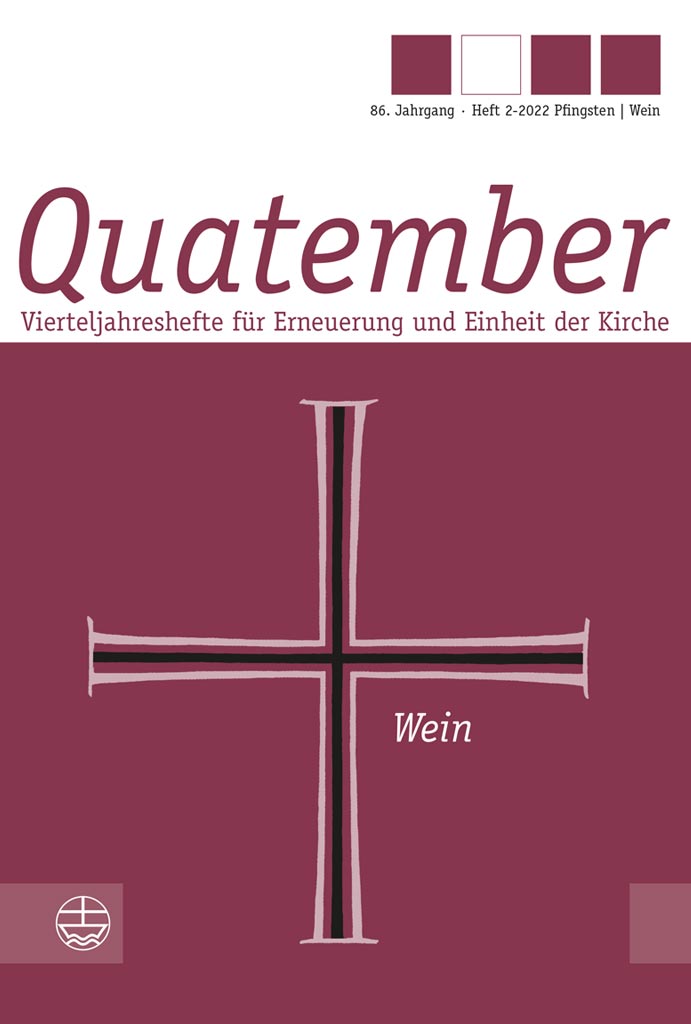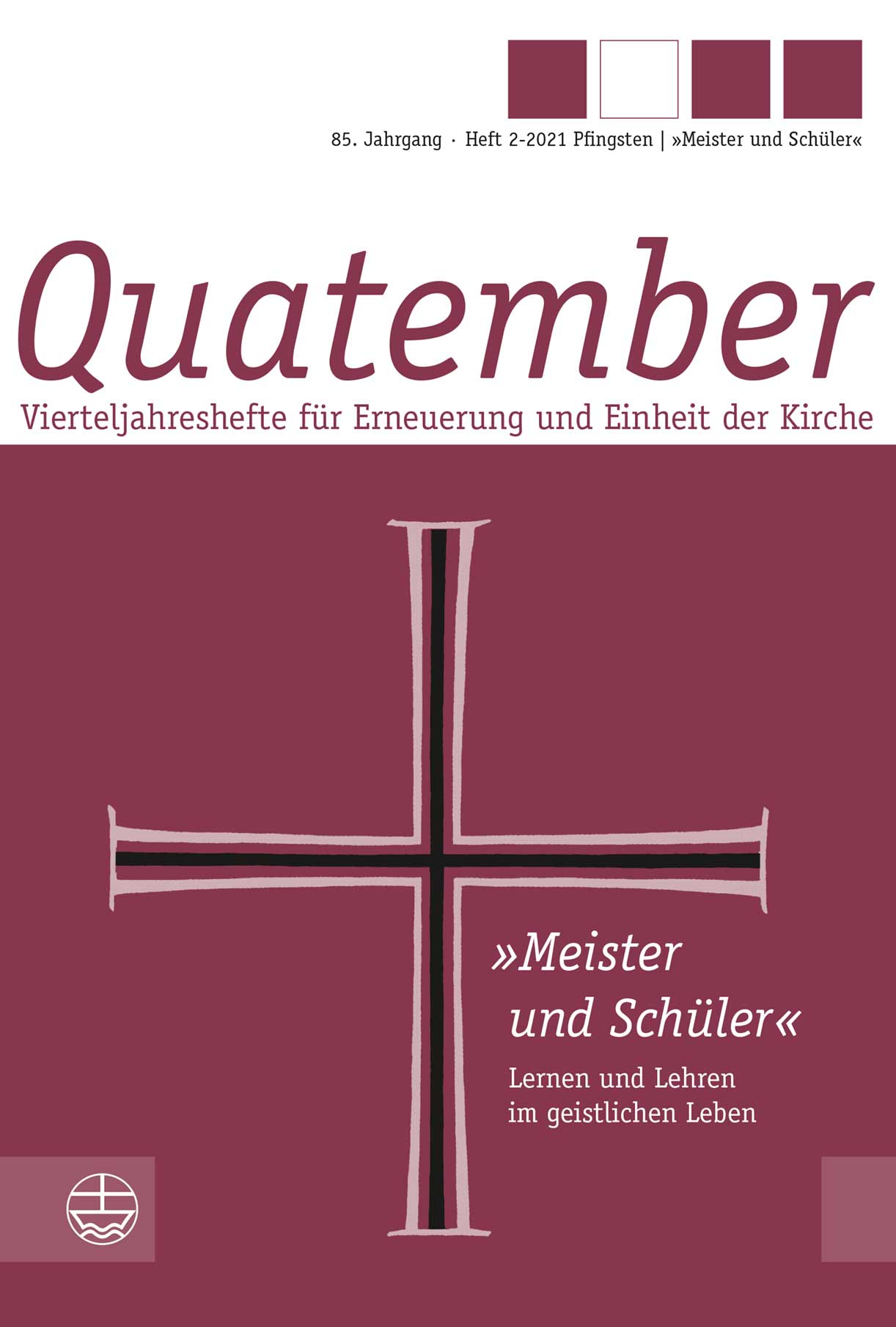4-2021 | Freundschaft
Inhalt
| Zur Einführung | |
| 334 | Roger Mielke: Freundschaft |
| Essays | |
| 340 | Hermann Michael Niemann: Freundschaft in der Bibel und im antiken Kontext. Ein Streifzug |
| 351 | Marco Hofheinz: John meets Aristotle |
| 366 | Ulrich Koring: Ein Weihnachtsbild im Kloster Kirchberg |
| Predigt | |
| 378 | Petra Reitz: Schweigen vor dem Geheimnis |
| Stimmen der Väter und Mütter | |
| 382 | Wulfert: Quellen aus der neueren Kirchen- geschichte zum Thema »Freundschaft« |
| Rezensionen | |
| 392 | Luca Baschera: Reinhard Thöle, Geheiligt werde dein Name. Christliche Gottesdienste zwischen Anbetung und Anbiederung |
| 395 | Hans Mayr: Adolf Klek, Glanzzeit und bitteres Ende im Frauenkloster Kirchberg 1688–1855 |
| 400 | Roger Mielke: Tom Kleffmann, Kleine Summe der Theologie |
| 404 | Adressen |
| 405 | Impressum |
Freundschaft
von Roger Mielke

Foto: Rolf Gerlach
»Über die Freundschaft aber denken sie alle ohne Ausnahme das gleiche: Wer sich der öffentlichen Tätigkeit widmet oder wer an wissenschaftlicher Erkenntnis seine Freunde hat und wer frei von Staatsgeschäften seinen eigenen Angelegenheiten nachgeht, schließlich auch wer sich gänzlich dem Genuss hingegeben hat – sie alle sind sich einig, ein Leben ohne Freundschaft sei kein Leben (sine amicitia vitam esse nullam), wenn man nur einigermaßen in Anstand leben wolle (liberaliter vivere).« Marcus Tullius Cicero, Laelius de amicitia – Laelius über die Freundschaft [1]
»Ist Freundschaft einer jener Strohhalme, an die wir uns klammern, während um uns herum die Welt zusammenbricht?«
Daniel Schreiber, Abschied [2]
In jedem Jahr am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages treffen wir alten Freunde uns, die wir damals im Frühjahr 1983 zusammen ihr Abitur abgelegt haben. Und, merkwürdig genug: Nach fast vierzig Jahren gibt es auch noch die schon in den achtziger Jahren etwas angegammelte Kneipe, in der wir als junge Leute so manchen Abend verhockt haben. Selbst das Mobiliar ist unverändert, und einige schon damals unvermeidliche Gäste sitzen heute noch auf demselben Stuhl an demselben Tresen, nur der Bart ist grau. Anders als Bertolt Brechts Herr K. haben sich die Freunde freilich verändert. Über Deutschland und Europa sind sie verstreut, obwohl auch mehr als einer der Vaterstadt treu geblieben ist. Beruflicher Erfolg hat den einen an die Spitze eines erfolgreichen Unternehmens geführt, den anderen hat ein Unfall aus der Lebensbahn geworfen. Zwei, immerhin, sind ganz kleinbürgerlich Pfarrer geworden.
Alte Freundschaften
Ist das Gewebe, das uns verbindet, mit den Jahren dichter oder dünner geworden? Beides zugleich, finde ich. Durch nichts zu ersetzen ist die lange gemeinsame Geschichte, eine Vertrautheit, die sich bei später im Leben gewonnenen Freunden kaum noch auf diese fraglose Weise einstellen kann. Eine Anspielung reicht, und schon sind die Männer wieder Jungs in der achten Klasse auf der Bank ganz hinten. Solche Regressionen braucht auch das Erwachsenenleben. Aber zwischen 1983 und heute ist im Leben der Einzelnen vieles geschehen, das wir nicht miteinander teilen oder vielleicht nur Einzelne von uns. Das heißt auch, dass die Kommunikation immer wieder zurückgeworfen wird auf das »Archiv« des Gemeinsamen. Neu Erworbenes zu teilen ist schwieriger als bei denjenigen, mit denen ich längere Zeiten des Alltags verbringe. Die Vertrautheit der Ehebeziehung etwa ist anders und tiefer, in mancher Hinsicht auch das Verbindende mit den Weggefährten im Beruf, von denen einige zu Freunden geworden sind. Und dann gibt es auch noch die unverhofften Begegnungen auf dem Lebensweg, bei denen sich ungesucht eine spontane Herzlichkeit, ein Gleichklang einstellt. Ein echtes Geschenk, für das die einen mehr Offenheit und Bereitschaft haben als andere. Es gibt so etwas wie eine Grundhaltung oder Tugend der Rezeptivität, des Resonierens. Es gibt das Talent zur Freundschaft.
Freundschaften in der geistlichen Gemeinschaft
Und die Freundschaft im geistlichen Leben? In den dreißig Jahren meines Wegesinder Bruderschaftsind Freundschaftengewachsen, ein wichtiger Teil des Lebens in der brüderlichen Gemeinschaft. Auch hier entstehen Resonanzräume, in denen Nähebeziehungen und Vertrautheit wachsen. Dies gilt, auch wenn das geistliche Begleiten in der Michaelsbruderschaft und in den Berneuchener Gemeinschaften als »Amt« konzipiert ist, und zwar als ein asymmetrisches Amt: Die Geschwister begleiten sich nicht gegenseitig, sondern eine oder einer begleitet den oder die andere und empfängt wiederum von einer anderen Person Begleitung. Trotzdem entsteht auch in den Beziehungen der Helfenden diese Vertrautheit, die zur Freundschaft werden kann. Etwas Besonderes ist es noch um die insgesamt wohl eher seltene Form von Freundschaft zwischen Angehörigen verschiedener Generationen. Die Aufgaben und auch die Rollen sind allerdings zu unterscheiden: Freund zu sein kann ein Auftrag sein, ist aber kein Amt, sondern eine Beziehungsqualität und eine Lebensform. Vermutlich ist aber die dauerhafte Nähe und auch die durch die, soziologisch gesprochen, organisationale Form der Bruderschaft gegebene Kontinuität dem Wachsen von Freundschaft eher günstig.
Freundschaft in der »Gesellschaft der Singularitäten«
Damit sind die in der Bruderschaft gegebenen Bedingungen für Freundschaft andere als diejenigen, die wir gegenwärtig als gesellschaftliche Bedingungen beobachten. In einer viel zitierten Analyse hat der Soziologe Andreas Reckwitz unsere Gegenwart als die »Gesellschaft der Singularitäten« genannt.[3] Mit dem Niedergang der tragenden Institutionen und der prägenden Milieus, die viele Menschen in einer gemeinschaftlichen Interessenlage verbunden haben, gehe es heute darum, sich vor den Augen eines allzeit zur Bewertung aufgelegten Publikums als »singulär«, einzigartig zu präsentieren. Ein kultureller »apertistischer« Liberalismus stelle neben allen anderen Produkten der kapitalistischen Warenwirtschaft vor allem das eigene Leben als das entscheidende aller Handelsgüter in das Schaufenster. Die sozialen Medien erscheinen dann als der große Marktplatz, auf dem um Sichtbarkeit und Anerkennung gerungen wird. Freundinnen und Freunde können, wenn es denn die richtigen sind, die Selbstpräsentation durchaus befördern. Wie ist es um die Freundschaft im »Zeitalter der Singularitäten« bestellt? Empirische Untersuchungen zur Soziologie der Freundschaft legen nahe, dass die Freundschaft gleichzeitig wichtiger und bedrohter ist als zu anderen Zeiten. Die Soziologin Sasha Roseneil spricht von »Neuen Freundschaftspraktiken«[4], die dort entstehen, wo die Ehen und Familien sich umgruppieren oder schlicht auflösen und auch Formen der Zugehörigkeit zu Kirchen oder Vereinen volatiler werden. Freundschaft dient »zur Wundheilung eines durch Individualisierungsprozesse beschädigten Selbst«[5]. Auch die Freundschaft muss dann aber individueller und kreativer modelliert werden, wird weniger eigenwüchsig, weniger selbstverständlich und damit auch stärker bedroht. Die Versuchung, Freundschaft als Accessoires der Selbstpräsentation zu sehen, gab es wohl immer, wird heute aber, nach der soziologischen Analyse, zum Gemeingut.
Der Autor Daniel Schreiber bewertet das in seinem schönen, die Erfahrungen der Pandemie resümierenden, Essay »Allein« auf folgende Weise: »Die meisten Freundschaften überstehen nur dann den Wandel der Zeiten, den Wechsel der Lebensphasen, der Orte, Haltungen und persönlichen Konstellationen, wenn man den narzisstischen Rausch des Sich-selbst-im-Gegenüber-Wiedererkennens hinter sich lässt. Nur mit jenen Menschen, mit denen mir das gelungen ist, bin ich heute noch befreundet.«[6] Freundschaft ist also zerbrechlich, kann abkühlen, scheitern und im Extremfall in Feindschaft umschlagen. Nur dort wird sie gelingen, wo der Freund nicht nur Spiegel der eigenen Bedürftigkeit ist.
Ganz im Einklang mit dieser Einsicht fasst Robert Spaemann die antike Freundschaftslehre so zusammen: »Der Freund … wird zwar nicht wegen irgendwelcher Eigenschaften geliebt, aufgrund deren er für mich nützlich oder angenehm ist, sondern um seiner selbst willen. Er besitzt menschliche Vorzüge, die ihn um seiner selbst liebenswert machen. Die Gemeinschaft mit ihm ist für seine Freunde eine Quelle des Glücks, ohne dass man sagen könnte, der andere würde wegen dieses Glücks geliebt.«[7] Freundschaft hat, Spaemann zufolge, ihren Ort in einem Prozess des Erwachens zur Vernunft, in dem ich auch zur Wirklichkeit des anderen als eines echten Gegenübers erwache. Dieses Erwachen zur Wirklichkeit aber ist dem Zwang zur Selbstpräsentation geradewegs entgegengesetzt. Damit haben wir die Freundschaft an ihren geistlichen, ihren theologisch zu beschreibenden Ort zurückgeholt: Die Mahnung des Epheserbriefes − »Wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten« (Eph 5,14) − kann in dieser Perspektive auch als Ermutigung zur Freundschaft gelesen werden.
Wir sind damit bei den Beiträgen dieses Heftes angelangt.
Mit einem »Streifzug« zu »Freundschaft in der Bibel und im antiken Kontext« eröffnet Hermann Michael Niemann das Heft. In der durch Clanund (Groß-)Familienbeziehungen geprägten Welt des Alten Orients ist die Freundschaft diejenige seltene und umso kostbarere, viel besungene und geschilderte Beziehungsform, in welcher die Antagonismen überwunden werden können. Die im Hintergrund der weisheitlichen Literatur liegende Krise der politischen Lebensund Sozialformen wandelt die Bedeutung der Freundschaft. Der hellenistische Einfluss macht sich in den Spätschriften des Alten Testaments in den deuterokanonischen Literatur und im jüdischen Schrifttum etwa eines Philo von Alexandrien bemerkbar, wohingegen die Erfahrung der ersten christlichen Gemeinschaften die natürlichen Bindungen von Familie und politischer Gemeinschaft durch etwas Neues von bleibender Bedeutung verändert.
Marco Hofheinz beschreibt, wie in der genialen Auslegung des Thomas von Aquin die antike aristotelische Freundschaftslehre durch die christliche Erfahrung verarbeitet und umgeformt wurde. In der Gottesliebe, so der Ertrag einer Lektüre des Johannesevangeliums, werden die durch ihr Selbstsein, Stand und Rang unterschiedenen Individuen derart zu Gleichen umgeformt, dass sie in Freundschaft miteinander verbunden sein können. Voraussetzung dafür ist die Menschwerdung, die Kondeszendenz des ewigen Wortes. Die Vertikale der Gottesliebe ermöglicht die Horizontale der Freundschaft. Diese aber zeigt sich als ein Ethos der Verbundenheit, das seinen Grund darin hat, dass die in Christus Verbundenen ihrerseits zur Freundschaft erwählt sind.
Ein Beitrag von Ulrich Koring bringt einen weihnachtlichen Ton in dieses Adventsheft. Er spürt den ikonographischen Traditionen nach, die hinter dem oft angeschauten und doch vielfach übersehenen Weihnachtsbild im Kloster Kirchberg stehen. In der Gestaltung besonders der drei Könige zeige sich der Universalismus der mittelalterlichen Christenheit: Orient, Okzident und der Südkontinent Afrika stehen anbetend vor dem Kind in der Krippe. Petra Reitz deutet in der hier wiedergegebenen Andacht zu Römer 16,25 f. die Covid19-Pandemie als eine Mahnung, sich der Unverfügbarkeit, der Nicht-Verrechenbarkeit Gottes zu stellen. Dies kann nur in der Übung des Schweigens, in der feiernden Anbetung fern alles hektischen Aktionismus geschehen. Dies muss die Kirche neu lernen.
Heiko Wulfert hat Quellen zum Freundschaftsthema aus der Kirchengeschichte der Neuzeit zusammengestellt. In großer Vielstimmigkeit reichen sie von Pascals »Zärtlichkeit des Herzens« über Zeugnisse aus der Tradition des Quäkertums (George Fox) und des Puritanismus (John Bunyan) bis hin zu Matthias Claudius’ volkstümlichen Mahnungen und Wilhelm Löhes ernster Neuformung der lutherischen Beichtpraxis.
Drei Rezensionen schließen das Heft ab: Reinhard Thöles unter dem Titel »Geheiligt werde dein Name« publizierte kritische Betrachtungen zum Gottesdienst werden von Luca Baschera besprochen, Adolf Kleks kundige historische Arbeiten zum Kloster Kirchberg, »Glanzzeit und bitteres Ende im Frauenkloster Kirchberg 1688–1855«, von Hans Mayr, und schließlich wird Tom Kleffmanns »Kleine Summe der Theologie« von Roger Mielke rezensiert.
In einer ganzen Reihe von Quatember-Heften waren bereits Fotografien von Rolf Gerlach zu sehen. Schon einige Leserinnen und Lesern haben nach dem Urheber der Fotografien gefragt. Rolf Gerlach ist in Remscheid geboren und hat an der königlichen Kunstakademie Antwerpen Grafikdesign studiert. Er lebt auch heute noch in Antwerpen und ist als Pädagoge an einer Förderschule tätig. Und: Er ist einer der Freunde, die 1983 Abitur gemacht haben und sich alljährlich am zweiten Weihnachtsfeiertag treffen. Im Übrigen hat er zugesagt, ein Heft des nächsten Jahrgangs als Illustrator zu betreuen. Für das Bisherige und das Kommende sei ihm an dieser Stelle herzlich gedankt!
Ein weiterer besonderer Dank soll und muss am Ende dieser Einführung stehen. Am 27. Juli dieses Jahres ist Ernst Hofhansl heimgerufen worden, prägender Bruder für den österreichischen Konvents und die gesamte Evangelische Michaelsbruderschaft. Auch dem »Quatember« war Ernst Hofhansl eng verbunden. Wir gedenken seiner in brüderlicher Liebe und Verbundenheit. Eine inhaltliche Würdigung der Arbeit von Ernst Hofhansl wird in einer der nächsten Ausgaben von Quatember erscheinen.
Mit diesem Heft zu den adventlichen Quatembertagen schließt nun der Jahrgang 2021. Als Schriftleiter wünsche ich allen Leserinnen und Leser ein gesegnetes und von der Gegenwart des Menschgewordenen geprägtes Christfest.
Ihr
Roger Mielke
| [1] | Marcus Tullius Cicero, Laelius de amicitia – Laelius über die Freundschaft (übers. und v. Marion Giebel), Ditzingen: Reclam 2015. |
| [2] | Daniel Schreiber, Allein, Berlin: Hanser 2021, |
| [3] | Andreas Reckwitz, Die Gesellschaf t der Singularitäten: Zum Strukturwandel der Moderne, Berlin: Suhrkamp, 4. A. 2019. |
| [4] | Sasha Roseneil, Neue Freundschaftspraktiken, in: Mittelweg 36, 3/2008, 55 – 70. |
| [5] | a. O. S. 64. |
| [6] | Schreiber, 51. |
| [7] | Robert Spaemann, Glück und Versuch über Ethik, Stuttgart: Klett-Cotta, 2. A. 1990, 130. |
Freundschaft in der Bibel und im antiken Kontext. Ein Streifzug
von Hermann Michael Niemann
Prof. Dr. Heinrich Holze, dem Fakultätskollegen und Freund, gewidmet
Wer hätte nicht im Leben eine Freundin, einen Freund gesucht, gefunden, bewahrt manchmal über Jahrzehnte – oder auch verloren? Ein vertrauensvolles und enges emotionales Verhältnis der Zuneigung, von unbedingter Verlässlichkeit, Hilfsbereitschaft und gegenseitigem Respekt geprägt und nicht auf Nützlichkeit aus, nennen wir Freundschaft, außerhalb oder auch innerhalb der Familie.
Biblische Welt
In der weitgehend dörflich geprägten Lebenswelt der Bibel, im zentralpalästinischen Bergland Israels und Judas in der Antike, bildet die (Kern-)Familie die grundlegende Lebensbasis. Die Familie ist eingefasst von der Sippe, dem Clan, also der Gruppe eng verwandter Familien, die sich auf einen gemeinsamen Vorfahren und seine Frau zurückführen. Ein solcher Clan ist nicht selten mit einem Dorf identisch und kann fünfzig bis hundert, oft mehr Personen umfassen. Solche Lebensgemeinschaften können über Jahrhunderte stabil sein. Als exemplarisch kann das Dorf Artas bei Bethlehem gelten, das im Jahr 1927 530 Einwohner zählte. Fast nur Frauen heirateten nach auswärts. Wenn man die relativ wenigen Frauen hinzurechnet, die aus einem Dorf im Fünf-Kilometer-Radius um Artas herum nach Artas hinein heirateten, sind 80 Prozent der Ehen, wenn man einen Zehn-Kilometer-Radius wählt, über 88 Prozent aller Ehen des Dorfes erfasst. Die Stabilität des Dorfs und des Clans ist damit deutlich. Ein Stamm hat wenig alltägliche Bedeutung in dieser Lebenswelt, er ist eine politische Einheit mit einem identitätsstiftenden (realen oder narrativen) Stammvater (z. B. Ephraim oder Juda, beides genau genommen Namen des von den beiden Stämmen jeweils bewohnten Gebirges). Der Stamm gewinnt i. d. R. nur in Krisenzeiten Bedeutung. Clans wie auch Stämme können sich allerdings auch spalten (Benjamin, d. h. »Süd-Sohn«, eine Abspaltung des nördlicher lebenden Stammes Ephraim). Clans finden sich zu einem neuen Stamm zusammen oder schließen sich einem anderen Stamm an. Die Solidarität in Familie und Clan ist nahezu bedingungslos, wie gegebenenfalls die Feindschaft erbarmungslos sein kann. Trotz aller gebotenen Selbständigkeit von Familie und Clan kommt es zu Freundschaften über Familien-, Clanoder Stammesgrenzen hinaus. Sie sind wohl nicht alltäglich, vielmehr etwas Besonderes. Und ob sie tragisch verlaufen oder glücklich ausgehen, sie bilden den Stoff für prägende, berührende Dichtung, so bei dem Freundespaar Orest und Pylades, wenn Euripides (485/84–406 v. Chr.) Orest sagen lässt:
Wieder zeigt sich: Habe Freunde, nicht verwandtes Blut allein! Wer mit meinem Sinn verbunden, sei er auch von fremdem Stamm, wiegt mir tausend Blutsverwandte durch die treue Liebe auf.« (Euripides, Orestes 804–805, zit. nach Kaiser 2015, 50)
Oder wer könnte von Friedrich von Schillers zutiefst bewegender Ballade »Die Bürgschaft« nicht wenigstens Teile rezitieren oder von dieser exemplarischen Freundschaft erzählen – und würde dabei nicht auch an die klassische Dichterfreundschaft Goethes und Schillers denken.
Altes Testament
Im Alten Testament wird der Bereich der Freundschaft, entsprechend seiner verschiedenen Ausprägungen, nicht mit einem einzelnen Begriff bezeichnet. Das Wort reaʿ bezeichnet den »Nächsten« in der Familie, den (verwandten nächsten) Nachbarn oder Clan-Angehörigen in einem engeren Sinn als wir ihn im neutestamentlich-christlich-ethischen Bereich anwenden. ʾohev meint einen »Liebenden«, einen Geliebten, einen, dem man/frau auch loyal zugeneigt ist. Chaver bezeichnet einen Kameraden. Alle drei Worte bezeichnen auch den Freund, wobei der literarische Kontext zusätzliche Aspekte liefert. Eine Besonderheit mag die Bezeichnung dod sein, die den Bruder des Vaters, also neben dem Vater als Familienoberhaupt das nächstbedeutende (männliche) Familienmitglied, den Onkel, bezeichnet, aber auch mit »Liebling, Geliebter, Freund« übersetzt werden kann. Gott rettet seine »Lieblinge« oder »Freunde« (Ps 60,7). Einzigartig herausgehoben sind freilich Mose, mit dem Jahwe in einer Unmittelbarkeit redet wie mit einem »Nächsten«, einem Verwandten, einem »Freund« (reaʿ) (Ex 33,11), und Abraham, der in 2Chr 20,7 ausdrücklich als »Freund« oder »Geliebter« (ʾohev) Gottes benannt ist. Als Nachkomme Abrahams, des Freundes Gottes, zu gelten, bedeutet enormen Trost für das exilierte Israel/Jakob (Jes 41,8).
Wir finden im Alten Testament oft eine große Nähe oder Parallelität zwischen Brüdern, denen man verwandtschaftlich bedingungslos verpflichtet ist, und (Wahl-)Freunden, denen die Verpflichtung ebenso, aber aus Neigung gilt (Spr 17,17; 19,7; 2Sam 3,8; 1Kön 16,11; Ps 35,13–14; 38,12; 88,19; 122,8; in negativem Kontext Ex 32,27; Dtn 13,7; Spr 14,20; Jer 9,3). Freilich ist der Fall denkbar, dass ein Freund sogar verlässlicher ist als ein Bruder (Spr 18,24). Freunde geben guten Rat (Spr 27,9), trösten (Klgl 1,2), und unter Freunden ist wohlmeinende Kritik wertvoll und akzeptiert (Spr 27, 5–6).
Spruchweisheit ist präzise und überzeugend, einprägsamer dürften lebendige und lebensnahe Erzählungen sein. Klassisch wie exemplarisch ist die Freundschaft von David und Jonathan (1Sam 18–20; 2Sam 1,17–27). Die biblischen Erzählungen zeigen Kolorit und Handlungsweisen und eine uns in der westlichen Welt fremd gewordene Gesellschaftsordnung von Familien und Clans, die in weiten Teilen der ländlichen Regionen des Nahen und Mittleren Ostens bis heute kaum verändert existiert. Die Söhne zweier verschiedener Clans, Jonathan, Sohn Sauls, des Benjaminiten, und David, Sohn Isais, ein Efratiter (Ephraimiter) schließen eine feste Freundschaft, indem Jonathan, der gesellschaftlich Höhergestellte, David symbolisch Kleider und sogar seine Waffen und Rüstung schenkt (1Sam 18,3–4). Damit sind sie nicht nur Waffen-, sondern Blutsbrüder. Dieses clanübergreifende Verhältnis zu dem erfolgreichen und daher nützlichen David will Jonathans Vater in hinterhältiger Absicht noch enger durch Aufnahme Davids in seine Familie gestalten (1Sam 18,17–30). Die farbig erzählten dramatischen Ereignisse und Wendungen sind hier weniger wichtig als die Tatsache, dass 1Sam 19 Jonathans und Davids Freundschaft und Bruderschaft sich sogar als stärker und tragfähiger erweisen als das traditionell äußerst enge Verhältnis von Vater (Saul) zum Sohn (Jonathan)! Jonathan verrät dem Freund die Mordabsicht seines Vaters. Diese bemerkenswerte Abweichung von uralter, lebenswichtiger Clanund Familiensolidarität steht – das wird zweimal betont – unter dem Schutz und Wohlwollen Gottes, wenn 1Sam 20,23.42 Jonathan betont: »Jahwe ist Zeuge zwischen mir und dir (zwischen meinen und deinen Nachkommen) für immer.« Die unverbrüchliche Freundschaft klingt auch durch die Totenklage Davids für den Freund und Bruder in 2Sam 1,17–27, ein Meisterwerk altorientalischer Epik. Hier wird der tödliche Zwist zwischen David und Saul ausgeklammert und auch Sauls Tod beklagt; die Klage steigert sich freilich noch, wenn es um den Tod des Freundes geht. Die Liebe zu Jonathan stellt der Sänger noch über die Liebe Davids zu seiner eigenen Familie (2Sam 1,26). Das Lied dürfte sehr alt sein und neben seinen konkreten Bezügen auf Saul, David und Jonathan auch typische Elemente der (Freundes-)Klage seiner Zeit enthalten.
In Psalm 133 geht es auf den ersten Blick nicht um Freunde und Freundschaft, aber im Lichte der Freundschaft und (Bluts-) Brüderschaft Jonathans und Davids mag das Wallfahrtslied hierhergehören. Es stellt die hochzuschätzende Freundschaft/ Bruderschaft mit zwei weiteren hochgeschätzten zeitgenössischen Aspekten zusammen, dem Gastmahl und dem lebensspendenden und lebenerhaltenden Tau. Der Psalm kommt dann auf dem Zion als Berg und Wohnstatt Jahwes beim höchsten Ziel von Gemeinschaft an. In der Kommentarliteratur wird wohl mit Recht auf die Vieldeutigkeit von »Bruder« als familiär-blutsverwandtschaftlich, auch als kultisch oder schließlich auch als politisch hingewiesen, die der Psalm vielleicht bewusst nicht auflöst.
Sieh, wie gut und wie schön ist es, wenn Brüder beieinander wohnen, wie das köstliche Öl auf dem Haupt, das herabrinnt auf den Bart, den Bart Aarons, das herabrinnt auf den Saum seiner Gewänder. Wie der Tau des Hermon, der herabfällt auf die Berge Zions. Den dort gewährt Jahwe den Segen, Leben bis in Ewigkeit.
Das Wallfahrtslied lebt von den beiden Vergleichen. Der eine ruft das Bild des Festmahls auf, bei dem die geehrten Gäste mit kostbarem Duftöl parfümiert feiern. Der zweite Vergleich erinnert in einem sonnendurchglühten Land an den kostbaren Tau, der in regenlosen oder regenarmen Jahreszeiten und in trockenen Regionen morgens Feuchtigkeit bietet. Beide Bilder sind im damaligen Lebenskontext höchst optimistisch und positiv. Das erste deutet bereits im Bild des festlichen, dem Alltag enthobenen Gastmahls die Begegnung mit einem hohen Gastgeber an. Mit dem zweiten Bild vom lebenserhaltenden und Fruchtbarkeit gewährenden Tau wird der festliche und segensreiche Bildgehalt noch einmal gesteigert: Die gedankliche Wanderung vom meist an der Spitze schneebedeckten Hermon mit seiner deutlichen Konnotation an den Gottesberg Zaphon im Norden hin zum Geber von Regen und Leben leitet die Freude und Erwartung eines Pilgers auf dem Weg zum Heiligtum und der Gottesbegegnung auf dem Zion, dem Ort des Segens und des Lebens. Der Gedanke an den Segen in Numeri 6,24–26 liegt nahe. Leben kann nur in harmonischer Gemeinschaft gelingen, sie steht unter dem Segen Gottes. Damit schlägt der Schluss des Psalms den Bogen zum umfassend gemeinten »Brüder-Bild« am Anfang.
Bei der Lektüre des Buches Hiob könnte der Gedanke aufkommen, die Wechselreden zwischen Hiob und den Freunden seien nicht mehr als ein literarisches Mittel. Aber dem ist beileibe nicht so. Selbst wenn Hiob und seine Freunde allmählich immer mehr in eine heftige Konfrontation geraten, trotzdem aber immer im Dialog bleiben, tun die Freunde doch zunächst genau das, was Freunde tun sollen: Sie kommen, sie sind bei ihm, sie schweigen zusammen mit dem vom Schmerz überwältigten Freund (2,13). Sie helfen ihm zunächst, seinen Schmerz aus-zu-drücken, ihn zu formulieren, aus der Schmerzüberwältigung auszubrechen, zu kommunizieren. Der von Gott gesandte Schmerz, das Unglück, hat ihn isoliert (19,13–19). Hiob sehnt sich nach Zuhörern, Menschen, die ihn verstehen und trösten (6,13–28; 19,21). Vielleicht befindet sich der Autor des Buches in einer Übergangssituation, in der die feste Verwurzelung des Einzelnen in Familie und Clan in den Dörfern der persischen Provinz Yehud und ihrer Umgebung im ausgehenden 5. bis zum frühen 3. Jahrhundert v. Chr. einer allmählich stärker werdenden individuellen Lebensweise und einer wachsenden Bedeutung der »Wahlfreundschaft« Platz machte, wie sie seit Ende des 5. Jahrhunderts v. Chr. auch in Griechenland beobachtet werden kann. Das könnte eine Stelle im Buch Kohelet (4,8–12) andeuten.
Judentum
Zwei herausragende Persönlichkeiten des antiken Judentums haben geradezu exemplarisch über das Thema Freundschaft nachgedacht und geschrieben. Es zeigt sich, dass ihr Nachdenken bei aller zeitgeschichtlichen Eingebundenheit weitgehend menschliche Allgemeingültigkeit beanspruchen kann.
Jesus Sirach, auch Ben Sira genannt, der erste Schriftsteller in der israelitisch-jüdischen Literatur, der seinen Namen nennt, greift das Thema der Freundschaft siebenmal auf. Das kann mit der Zeitgeschichte zusammenhängen, da im ersten Drittel des 2. Jahrhunderts v. Chr. Hellenisierungstendenzen zu Spannungen in der jüdischen Gesellschaft und ihren Familien zwischen »Konservativen« und »Progressiven«, Alten und Jungen führte, was die Bedeutung von »Wahlfreundschaften« gefördert haben mag.
Der erste Text Ben Siras über Freundschaft ist kunstvoll gestaltet durch Stichwortverbindungen. Bei vielen Freunden ist es wichtig, den einen, besonders Vertrauten und Bewährten zu erkennen und auf ihn zu setzen, wenn andere sogenannte Freunde oder Nutz-Freunde im Unglück das Weite suchen.
Ein getreuer Freund ist ein starker Schutz, wer ihn gefunden hat, hat einen Schatz gefunden. Für einen treuen Freund gibt es keinen Kaufpreis, und es gibt keinen Preis für seinen Wert. Ein Unterpfand des Lebens ist ein treuer Freund, wer Gott fürchtet, wird es erlangen (6,14–16).
Das Wort für »Unterpfand« bedeutet genauer »Bündel« und erinnert an den »Beutel der Lebenden« in 1Sam 25,29, sprichwörtlich für einen Proviantbeutel, den Hirten für Notfälle unter dem Gewand »am Herzen« tragen. 1Sam 25,29 wünscht die kluge Abigail David, dass er in der Not in diesem Beutel bewahrt bleibe »beim Herrn, unserem Gott«, also am Herzen Gottes. Ein Spruch über Freundschaft gipfelt bei Gott! Freundschaft wird hier zum hohen, vielleicht zum höchsten Gut erklärt, das in der Ehrfurcht vor Gott verankert ist.
19,8–19 denkt über angemessenes Reden und Schweigen gegenüber Freund und Feind nach.
Über einen Freund und über einen Feind erzähle keine Geschichten, Und wenn dir keine Schuld zuteilwerden soll, so enthülle nichts (V. 8).
Der Weise fragt nach, wenn er etwas gehört hat, ob es zutreffe, und wenn es Probleme gibt, sei der Freund unter vier Augen zu ermahnen und ihm so zu helfen. Eine ungeprüfte und weiter erzählte Geschichte über den Feind führt leicht zu bitterem Hass desselben. Generell weist Ben Sira auf häufige Verleumdung oder auch Versehen beim Weitererzählen. Ben Siras praktische Lebensweisheit schlichtet statt zu polemisieren und zu spalten. Solche Weisheit hat einen hohen Lohn, denn
Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Einsicht, die Weisheit, die von ihm kommt, verleiht Liebe. Die Kenntnis der Gebote des Herrn bedeutet eine Erziehung zum Leben. Die, die das, was ihm gefällig ist, tun, werden am Baum der Unsterblichkeit ernten (V. 18–19).
Im Unterschied zum biblischen Buch der Sprüche, einem Sammelwerk mit Texten aus dem Ende des 7. Jahrhunderts bis etwa zum 4. Jahrhundert v. Chr. (oder etwas später), wo die Familie, der Clan im Mittelpunkt von Denken und Handeln steht, wird bei Ben Sira der individuelle Aspekt der Freundschaft stärker hervorgehoben, so in 22,19–26. Der Text spricht statt der beglückenden Dimension gewonnener und bewährter individueller Freundschaft auch mögliche Gefährdung an und rät dazu, eine Schlichtung zu versuchen, um einen bewährten Freund nicht leichtfertig und dauerhaft zu verlieren.
Wenn du gegen einen Freund das Schwert gezogen hast, lass die Hoffnung nicht fahren; denn es gibt noch einen Rückweg. Wenn du gegen einen Freund den Mund aufgetan hast, betrübe dich nicht; denn es gibt eine Versöhnung (V. 21–22).
27,16–21 setzt der hochgeschätzten Freundschaft als höchstem Gut eine Grenze, die ein Freund nicht berühren oder gar überschreiten darf:
Einen treuen Freund vertreibt Verhöhnung, wer aber ein Geheimnis bewahrt, ist ein rechter Freund. Liebe den Freund und sei ihm ein Vertrauter; wenn du aber seine Geheimnisse verrätst, kannst du nicht mehr mit ihm zusammengehen. (…) Denn eine Wunde kann verbunden werden, und üble Nachrede lässt sich versöhnen, wer aber ein Geheimnis kundtat, hat keine Hoffnung (27,16–17.21).
Ben Sira zielt in 37,1–6 auf die Differenz zwischen Freunden in der Tat und der Bewährung und solchen, die sich nur leichthin »Freunde« nennen:
Ein jeder Freund spricht: »Ich bin dein Freund.« Es gibt aber einen Freund, der nur den Namen »Freund« trägt. Ist es nicht ein Kummer, der nahe an den Tod heranführt, wenn ein Freund, der dir so viel wert ist wie dein Leben, sich in einen Feind verwandelt?
Die Enttäuschung über den Verrat eines Freundes nur dem Namen nach grenzt an Trauer und Tod (V. 2). Hier markiert Ben Sira scharf die Gegenseite der Freundschaft als höchstem Gut. Der Freund der Tat dagegen teilt Tischund Kampf-Gemeinschaft (V. 4–6).
Jn 25,1–6 geht Ben Sira schließlich über die individuelle Freundschaft hinaus:
An drei Dingen habe ich Wohlgefallen, sie sind angenehm vor dem Herrn und vor Menschen: Eintracht unter Brüdern und Freundschaft unter Nächsten und dass Frau und Mann miteinander gut auskommen (V. 1).
Gegenüber Negativbeispielen des Alltags (V. 2) kann nur einerseits die in V. 1 beschriebene harmonische Gemeinschaft im Kern der Familie, wo zuerst die Frau (!) genannt wird, und die Freundschaft (V. 1) als solide Grundlage bestehen und Leben gelingen. Hier stehen Brüder und Freunde nebeneinander; es können Brüder (wie) Freunde und Freunde (wie) Brüder sein. Für die übergeordnet-umgreifende weitere Ebene der Gesellschaft andererseits betont Ben Sira nicht etwa die Autorität von Fürsten, Priestern oder anderer traditioneller Eliten, sondern die Bedeutung der Alten, ihre Erfahrung, Urteilskraft, Rat und Weisheit und Ehrfurcht gegenüber Gott (V. 3–6). Nur auf dieser Basis kann das Gemeinwohl blühen. Ein folgender neunund zehngliedriger Zahlenspruch (V. 7–12) gipfelt in der Ehrfurcht vor Gott in Verbindung mit der Gottesliebe und dem Glauben.
Philo von Alexandrien, einer der prägendsten Denker des Judentums (20/10 v. Chr.–ca. 45 n. Chr.), spricht oft über die Freundschaft als grundlegende Existenzweise, als innige Lebensgemeinschaft in personaler, ethischer, sozialer und ökonomischer Hinsicht. Er steht damit auf den Schultern Ben Siras und in weitgehender Übereinstimmung mit griechisch-klassischer und hellenistisch-römischer Philosophie.
Philos Gedanken über die Freundschaft sind mit den Auffassungen antiker Schriftsteller vor und nach seiner Lebensphase weitestgehend kompatibel. Im Rahmen frommer jüdischer Existenz sah Philo in seiner Schrift De vita contemplativa das zeitgenössische Freundschafts-Ideal in der klassenlosen essenischen Gemeinschaft der Therapeuten am reinsten verwirklicht. Dass er im weltläufigen Alexandria im Umgang mit nichtjüdischen Mitbürgern dabei die jüdischen Reinheitsgebote einzuhalten hatte, bleibt unbenommen. Seine eigene Position zur Freundschaft wird bei einem Streifzug durch Positionen griechischer und römischer Philosophen deutlich.
Freundschaft ist nach Demokrit von Abdera (ca. 460–380/370 v. Chr.) und Xenophon (ca. 430/25–370/360 v. Chr.) geprägt durch Freimut als Merkmal der Freiheit, deren Inanspruchnahme nach Demokrit den wesentlichen Grundzug des politischen Lebens Athens ausmacht. Freimut ist auch für den Monarchen von höchstem Wert, wenn er seinen Freunden Freiheit der Rede gewähre, denn treue Freunde seien die beste Leibwache. Freundschaft zeigt sich in gemeinsamem Tun des Guten nach den klassischen Tugenden Klugheit, Tapferkeit, Selbstbeherrschung, Gerechtigkeit sowie Frömmigkeit, Menschenliebe und Weisheit. Freundschaft bewirkt harmonische Gleichheit und Übereinstimmung, die Differenzen in liebevoller und respektvoller Offenheit klärt. Xenophon sieht als Soldat und Landwirt Freundschaft sehr praktisch als Lebensgemeinschaft im Glück und vor allem auch im Unglück als zuverlässiges und kostbares Gut. Aristoteles (ca. 382–322 v. Chr.), ein »Lehrer des Abendlandes«, bezeichnet in seiner Ethik Freundschaft als das fürs Leben Notwendigste und zusammen mit der Gerechtigkeit als Grundlage staatlichen Lebens. Sie geht über die Kreise der Blutsverwandtschaft und der Freunde hinaus und hat
in der Gastfreundschaft und im Austausch von Freundschaftsgeschenken weiterreichende Bedeutung. Er unterscheidet zwischen der schwankenden Nutzfreundschaft und der dauerhaften Freundschaft, die auf der Freundschaft des Menschen mit sich selbst beruht. Zur wahren Freundschaft gehören Takt und Rücksicht, die den Freund möglichst wenig belastet, aber ihm von sich aus beisteht. Aristoteles empfiehlt, lieber mit weniger Freunden Kontakt zu pflegen, aber vielen freundschaftlich zugeneigt zu sein, viele Freunde am eigenen Glück teilhaben zu lassen, aber wenige zögernd beim eigenen Unglück zu belasten. Epikur (342/341–271/70 v. Chr.) in einer veränderten Zeit, als der Mensch nicht mehr primär Glied seiner Polis, seiner Ortsgemeinde, sondern eher als Einzelner gesehen wird, sieht den Menschen individuell für sein Glück verantwortlich. Angesichts von Furcht vor den Göttern und den Übeln des Aberglaubens bezeichnet er in seinen Sentenzen Lust als unbedingtes Gut und Schmerz als großes Übel, ohne die Ethik aufzulösen. Denn zwischen einem lustvollen und einem gerechten, einsichtigen Leben bestehe ein reziprokes Verhältnis. Gerechtigkeit und Selbstgenügsamkeit bewahren vor Störungen der Seelenruhe und ihre Frucht sei (innere) Freiheit. Ohne Freundschaften sei das Leben voller Bedrohungen, also gebiete schon die Vernunft Freundschaften als höchstes Gut, als größte Lust. Auch die von Philo geschätzten frühen Stoiker, z. B. der Gründer der Schule der Stoa, Zenon von Kition (ca. 333/32–262/61Chr.), betrachten Freundschaft als höchstes Gut. Freundschaften soll man nur langsam schließen, sie bewähren sich besonders im Unglück. Cicero (106–43 v. Chr.) hat in seiner Schrift De amicitia dargelegt, was Freundschaft sei, worin ihr Wert besteht und welche Regeln zu befolgen seien. Grundlegend sei Übereinstimmung in allen Dingen, Zuneigung und Liebe, die Quelle der Freundschaft sei die Tugend. Sie erhält die Freundschaft, weil sie auf vollkommener Harmonie und Neigung beruht. Tugend und Freundschaft stehen für Cicero in einem engen, unauflöslichen Verhältnis. Freundschaft wird nicht aus (wandelbarer) Nützlichkeit, sondern aus Zuneigung geschlossen, deren Stabilität sich in Unsicherheiten bewährt. Schalom Ben-Chorin zitiert Cicero in seiner Darstellung jüdischen Glaubens:
Gibt es etwas Beglückenderes, als einen Menschen zu kennen, mit dem man sprechen kann wie mit sich selbst? Könnte man höchstes Glück und tiefstes Unglück ertragen, hätte man niemanden, der daran teilnimmt? Freundschaft ist vor allem Anteilnahme und Mitgefühl.
Der Stoiker Seneca (ca. 5/4 v. Chr.–65 n. Chr.) rät, bei der Wahl von Freunden vorsichtig zu sein, erst zu beobachten und zu urteilen, dann den gewonnenen Freund zu lieben und ihm zu vertrauen. Liebe (amor) und Freundschaft (amicitia) seien nicht identisch. Liebe sei eine dem anderen entgegengebrachte starke Zuneigung, Freundschaft darüber hinaus eine geistige Gemeinschaft, die den anderen um seiner selbst willen bejaht. »Wer ein Freund ist, liebt, wer liebt, ist aber deshalb noch kein Freund.« Dabei soll der Freund sich selbst treu bleiben, so dass er ein echtes Gegenüber des Freundes sei. Mit Euripides (Fragment 1079) gesprochen:
In Leid und Kummer gibt es für den Menschen Kein andres Mittel als den Zuspruch edlen Freundes.
Der an praktischen Anweisungen für ein gelingendes Leben interessierte Epiktet (ca. 50/60–135 n. Chr.), manchmal als stoischer Humanist bezeichnet, empfahl Gottergebenheit, Selbstzucht und Brüderlichkeit. Interesse und Liebe des Menschen sei von Selbstliebe geleitet, aber wenn sittliches Streben die Oberhand gewinnt, könne man zum vorbildlichen, treuen und achtbaren Freund werden.
Neues Testament
In der urund frühchristlichen Gemeinschaft im Rahmen ihres jüdischen Kontextes gelten sehr viele der im alttestamentlichen Kontext beschriebenen Auffassungen von Freundschaft ungebrochen weiter. Jesus nennt seine Jünger seine »Freunde« (Lk 12,4; Joh 15,12–17). Der Jakobusbrief (2,23) erinnert an den Würdetitel Abrahams als »Freund Gottes«; das unterstreicht das Gewicht der Jünger-Bezeichnung als Jesu Freunde. Wir treffen auf ein geschwisterlich-familiäres (Ideal-)Verständnis von Brüdern und Schwestern im Glauben (Phil 1,12; 2,2.30; 3,1.17; 4,1; 1Thess 4,9 u. ö.), das die Blutsverwandtschaft überschreitet, wo die Linien der Blutsverwandtschaft und der freundschaftlichen Lebensgemeinschaft (3Joh 15) sich verbinden und gemeinsamer Besitz vorherrscht (vorherrschen soll) (Apg 2,44; 4,32). Die Verbundenheit im Glauben an den auferstandenen Christus überwölbt Familie und Freundschaft. Das wird u. a. auch deutlich in Römerbrief 16,1–16 mit der großen Zahl von offensichtlich herausragenden, aktiven Angehörigen der geschwisterlichen Gemeinde im Glauben, unter denen eine bemerkenswert große Anzahl von tätigen Frauen namentlich genannt wird. Otto Kaiser macht darauf aufmerksam, dass der heilige Augustin der Freundschaft dann wieder einen größeren Raum widmet und das antike Freundschaftsideal christlich übernahm, »so dass die Freundschaft ihre Erfüllung in der Gemeinschaft der Christen als dem corpus Christi mysticum fand« (Kaiser 2015, S. 74). Ist es zu schroff oder einseitig zu sagen: Ohne Liebe und Freundschaft ist alles nichts? Oder: Ein Leben ohne Freundschaft und Liebe ist kalt und leer? Kann man die Freundschaft als Schwester der Liebe bezeichnen? Das mag jede und jeder für sich beantworten. Der Streifzug durch die biblische und die jüdische Auffassung der Freundschaft bei Ben Sira und dem klassischgriechischen und hellenistisch-römischen Kontext vor, bei und nach Philo von Alexandrien zeigt deutlich, wie zeitlos Freundschaft als grundlegende menschliche Existenzweise war und ist. Formen der Freundschaft, ihre Gestaltung und Pflege mögen sich wandeln. Es war und ist nie gut, dass der Mensch allein ist (Gen 2,18). Freundschaft wie Liebe trotzen dem Tod (Hld 8,6) – und können ihn überdauern. Der Mensch war von allem Anfang und ist und bleibt ein Beziehungsund Gemeinschaftswesen mit dem Bedürfnis, von anderen allein um seiner selbst willen angenommen, gehört und verstanden zu werden, in einer komplizierter und unübersichtlicher werdenden Welt, in der weniger aufeinander gehört als übereinander gesprochen, geschrieben, getwittert und retweetet wird, womöglich mehr als je zuvor.
Literatur:
Ben-Chorin, Schalom: Jüdischer Glaube, Tübingen 1975
Kaiser, Otto: Das höchste Gut. Philos Hochschätzung der Freundschaft im Horizont ihrer antiken Geltung. Stuttgart 2015
Kreuzer, Siegfried: Freundschaft, in: Michael Fieger / Jutta Krispenz / Jörg Lanckau (Hgg.), Wörterbuch alttestamentlicher Motive. Darmstadt 2013, 166–170
Philo: Die Werke in deutscher Übersetzung, hg. v. Leopold Cohn, Berlin 21962–1964
Reiterer, Friedrich V. (Hg.): Freundschaft bei Ben Sira. BZAW 244, Berlin – New York 1996
Sauer, Georg: Jesus Sirach. Jüdische Schriften aus hellenistisch-römischer Zeit. Band III, Lieferung 5, Gütersloh 1981
Prof. em. Dr. Hermann Michael Niemann, geb. 1948, ist Bruder der Evangelischen Michaelsbruderschaft im Konvent Norddeutschland. Er lebt in Rostock/Mecklenburg. Bis 2014 lehrte er Altes Testament und Biblische Archäologie an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Rostock.
Schweigen vor dem Geheimnis
Andacht zu Römerbrief 16,25–26*
von Petra Reitz
Aufgescheucht durch die Einschränkungen, in die uns die Corona-Pandemie eingepfercht hat, entwickeln wir eine erstaunliche Hektik und Atemlosigkeit, weil uns die vertrauten Kommunikationswege verwehrt sind und »Praesenz« – zumindest analog – nicht mehr möglich zu sein scheint. Und so haben wir uns auf digitale Kommunikationsmittel verlegt, die uns wenigstens ein Mindestmaß an Kontakt und Kontinuität ermöglichen sollen. Wir versuchen, uns im Gespräch zu halten, uns hörbar zu machen. Es sieht so aus, als seien wir getrieben von der Angst, als Kirche den gesellschaftlichen Anschluss zu verlieren, wenn wir nicht in einer Dauer-Kommunikation stehen und uns als Kirche im Gespräch halten.
Doch worum geht’s denn? Um die Kirche? Nein, natürlich, es geht um die »Gute Botschaft« … und zwar so wie eine spät-volkskirchliche Institution sie verstehen will: der stets gleiche, vernünftige »liebe G’TT« meint es immer nur gut mit uns.
Und weil ER es vernünftigerweise gut mit uns meint, ist er auch berechenbar.
Deshalb war es ja so irritierend, dass dieser G’TT – als die Pandemie ausbrach – es offenbar gar nicht gut mit uns zu meinen schien. Erschrocken wusste die sonst so redselige Kirche, die alles ungefragt kommentiert, zunächst nichts zu sagen. Das Einzige, was wortreich zu hören war, war, dass diese Pandemie nicht von G’TT kommt. Woher wussten die Kirchen das?
Vielleicht muss die Kirche neu lernen, sich auf G’TT, der außerhalb ihrer eigenen Verfügbarkeit ist, einzulassen; vielleicht muss sie neu lernen, sich IHM auszusetzen, IHN wirken zu lassen – jenseits eigener Vorstellungen. Das aber hat zur Voraussetzung, dass sie zunächst einmal schweigt über Dinge, die sie selbst nicht versteht. Dass die Kirchen zunächst nichts gesagt haben, als die Pandemie begann, ist noch kein Schweigen, denn sie haben ja etwas gesagt: Sie haben gesagt, dass diese Pandemie nicht von G’TT kommt! Im spät-volkskirchlichen Gottesbild ist ein G’TT, der Wege verstellt, der Herzen verhärtet, der sich selbst verbirgt, auf viel zu
gefährliche Weise unkalkulierbar; denn für die Kirche ist G’TT stets derselbe vernünftige »liebe G’TT« – doch das widerspricht auf eklatante Weise seiner Personalität! Personalität meint eine lebendige Energie, die wirkmächtig ist – und keineswegs gleichbleibend.
Ihnen, liebe Schwestern und Brüder, müsste als Theologinnen und Theologen, noch der Begriff »Revelationsschema« bekannt sein. Das Revelationsschema beschreibt die biblische Vorstellung, dass mit der Schöpfung zusammen »Geheimnisse« in ihr »eingewickelt« wurden, die erst im Laufe der Zeit – mit gehöriger Verzögerung – »ausgepackt« werden können. Mit dem Kommen Christi beginnt diese Zeit der Freilegung, der Offenbarung göttlicher Geheimnisse, sie ist aber noch immer nicht zu Ende. Und die angemessene Form, dem Geheimnis zu begegnen, ist Schweigen. Wenn das Neue Testament von der »Offenbarung Jesu Christi« redet, ist damit aber noch keine Enthüllung vor aller Welt gemeint, sondern zunächst einmal vor Auserwählten: Wir kennen dies aus den Gleichnissen, die aller Welt erzählt (vgl. Mt 13,1–8: Gleichnis vom Sämann), dann aber nur für die Jünger näherhin eröffnet werden (vgl. Mt 13,10–23).
Auch unser Text geht davon aus, dass zwar den Propheten das Geheimnis offenbart wurde, dann aber verschwiegen; und jetzt neuerlich enthüllt als Evangelium (»Gute Botschaft«) Jesu Christ durch den Dienst des Apostels Paulus, was aber keineswegs heißt, dass es allgemein offenbar ist, sondern noch in einem Prozess der Offenbarwerdung steht.
Das bisherige Verhalten der Kirchen, als wüssten sie schon, wer G’TT ist, was ER denkt und wie ER handelt, ist eine gefährliche Art der G’TT-Behauptung, die durch die jüngsten Ereignisse (und hier meine ich nicht nur die Pandemie) in jedweder Art hinterfragt ist – und zwar massiv hinterfragt ist!
Wir, als ordinierte Dienerinnen und Diener in dieser Kirche, sind davon existentiell mitbetroffen. Und jeder lügt sich hier in die Tasche, der das leugnen wollte!
Wie schon nach der Pest im 14. Jahrhundert, die das Spätmittelalter beendete und die Vorbotin für die Renaissance wurde, könnten wir vor, oder besser: schon längst in einer Zeitenwende stehen, die nicht vordenkbare Veränderungen für uns bereithält.
Mit dem Apostel Paulus möchte man ausrufen:
»das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden« (2Kor 5,17b), oder besser: ist im Werden!
Dieser uns vertraute Satz hat aber einen Vorsatz, den man in seiner Valenz schnell überliest:
»Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.« (2Kor 5,17)
Sind wir in Christus? – Sind wir es wirklich?! Ist es nicht vielmehr so bei der Kirche (und damit auch bei uns), dass Christus zu einem »tool« geworden ist, das ich – je nach Bedarf – in meiner Interpretation der Welt zur Sprache bringe? Dass wir eher nicht in Christus sind, dafür gibt es einige Anzeichen: Denn das »Sein-inChristus« ist zunächst einmal ein IN-Sein und kein Außer-sichSein! Die hektische Atemlosigkeit, mit der Kirche und auch wir herumagieren, zeugt mehr vom Fehlen des Heiligen Geistes als von Seiner Anwesenheit! Denn die Energie, die bewegt, ist nicht angewiesen darauf, dass ich etwas in Gang setze!
Vielleicht muss die Kirche neu lernen, sich auf den Geist G’TTES einzulassen, sich IHM auszusetzen, IHN wirken zu lassen – jenseits eigener Vorstellungen. Das aber hat zur Voraussetzung, dass sie zunächst einmal schweigt über Dinge, die sie selbst nicht versteht. Wir betonen im Christentum – auch im Gegenüber zum Islam – immer wieder die Personalität G’TTES, wollen dann aber scheinbar nicht akzeptieren, wenn ER nicht so will wie wir.
In unserer Theologie und unserem praktischen Kirchenleben haben wir in den zurückliegenden Jahrzehnten das Ethische akzentuiert, was immer dann schlecht ist, wenn man es vom Kontemplativen, Festlichen und Liturgischen trennt. G’TT als G’TT zu feiern – den Unverfügbaren, der mir auch dunkel und fremd erscheinen kann, dem ich mich nur nähern kann durch Christus, was aber auch nicht ohne Übung geht, weder ohne kontemplative Übung noch ohne liturgische, gilt es neu zu entdecken.
Liturgisches Verhalten, in dem die »Witzischkeit« an ihre Grenze kommt, hat mit der ›Ehre G’TTES‹ nichts mehr zu tun. Die Frage, ob wir G’TT noch G’TT sein lassen können, muss gestellt werden.
Denn – gemäß unseres Textes – gebührt diesem »G’TT, der allein weise ist, … Ehre durch Jesus Christus in Ewigkeit! Amen.«
Sankt Augustin in der Trinitatiszeit 2021
Petra Reitz, geb. 1961 in Witten a. d. Ruhr, Freundin im Konvent Nord der Gemeinschaft St. Michael. Stipendium beim »Evangelischen Studienwerk Villigst«, Studium in Bonn, seit 1981 Geistliche Begleitung durch P. Dr. Anselm Grün OSB, Exerzitien-Leiter-Ausbildung bei den Jesuiten, 17 Jahre Gemeindepfarrerin am linken Niederrhein, Exerzitienbegleiterin in der »Qualifikation Geistliche Begleitung« der EKiR, seit 2010 in der Militärseelsorge und seit 2017 erste Leitende Militärdekanin Westdeutschlands mit Dienstsitz in Köln.
*Diese Andacht wurde anlässlich des Deutsch-Niederländischen Konventes 2021 der Evangelischen Militärseelsorge, Konvent West, gehalten.