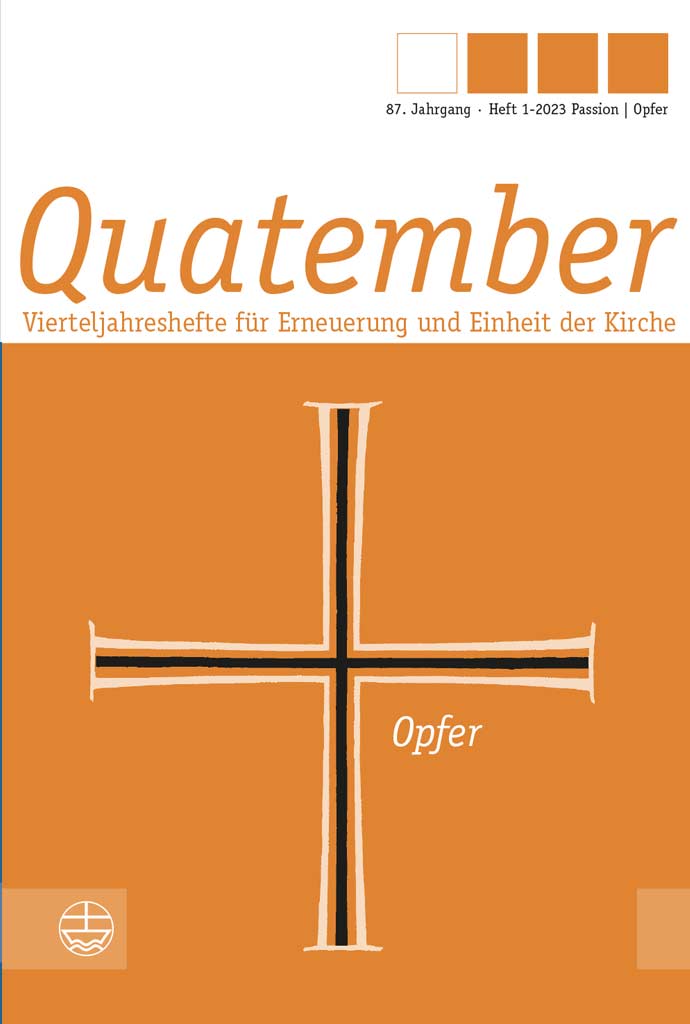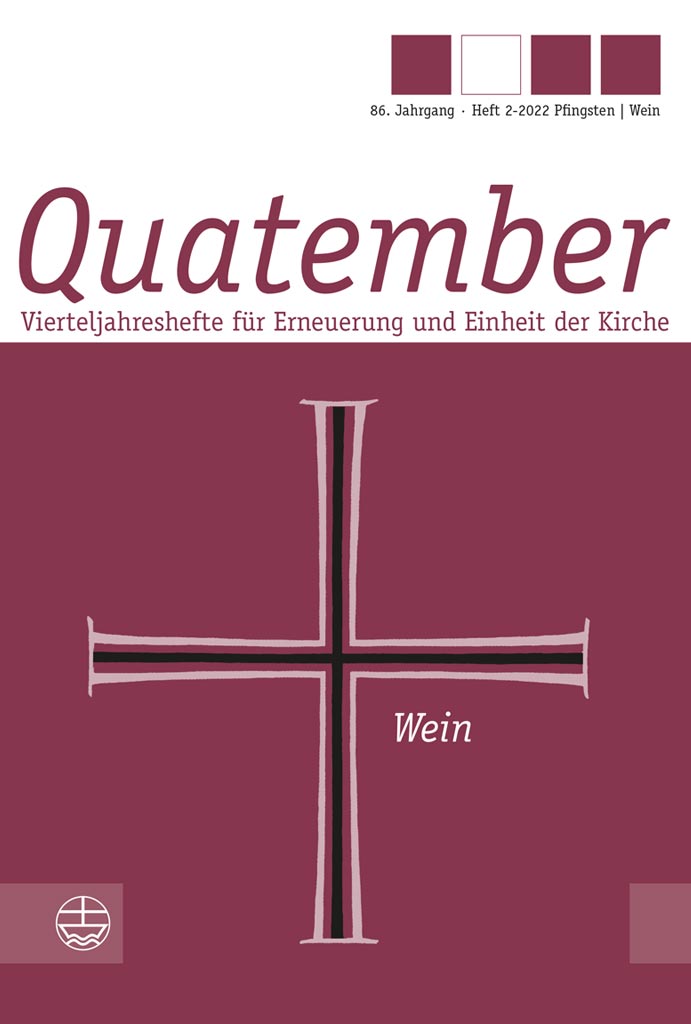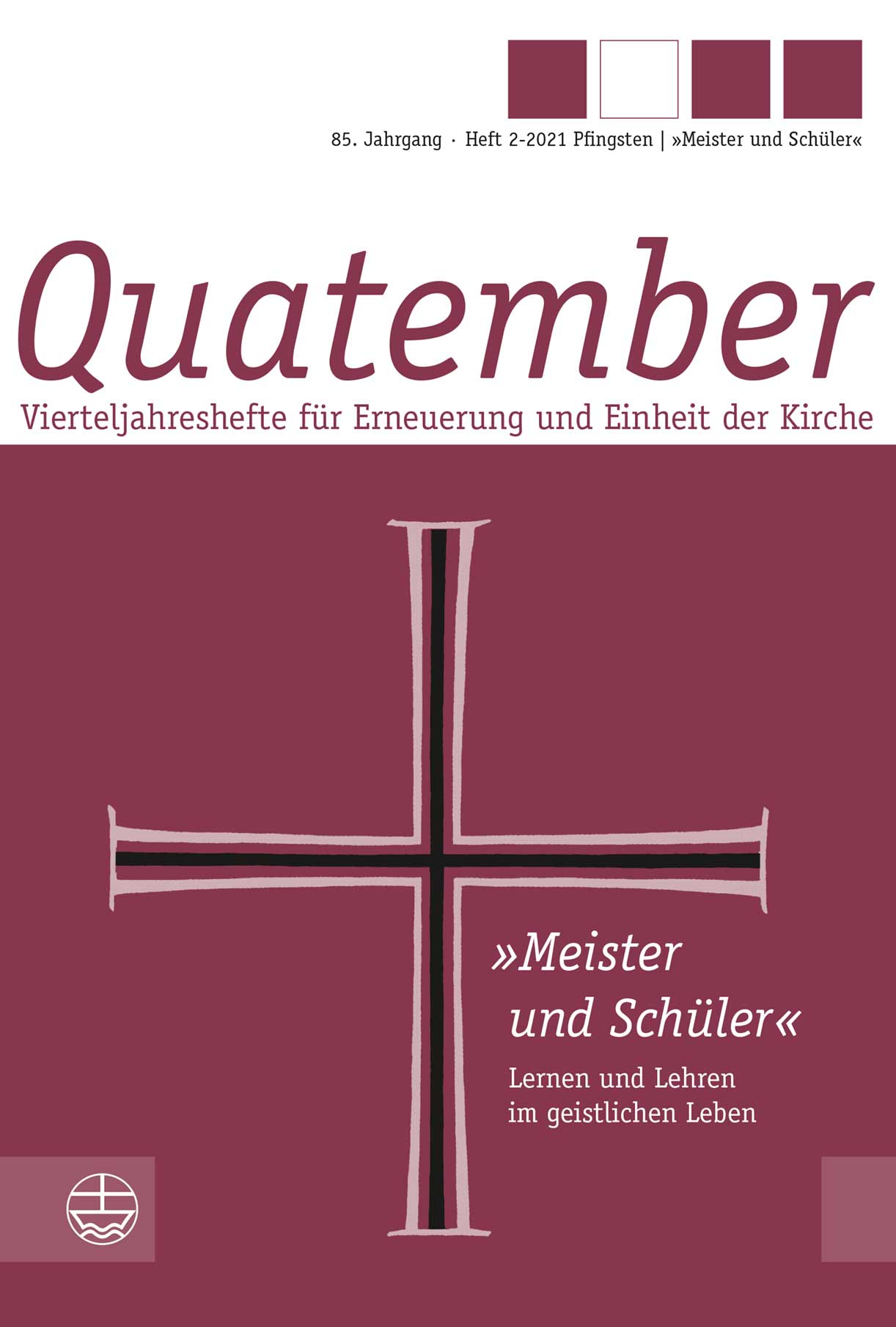3-2021 | Macht
Aus diesem Heft:
Inhalt
| Zur Einführung | |
| 232 | Roger Mielke: Macht |
| Essays | |
| 237 | Ralph G. Schöne: Macht und Ohnmacht – eine teure Münze |
| 246 | Christoph Thiele: Macht als Gabe Gottes |
| 254 | Reinhold Janke: Militär, Macht und Moral. Gedanken eines Soldaten |
| 265 | Hans Mayr: Dante Alighieri zum 700. Todestag |
| 275 | Axel Mersmann: Von »stillen Stars« – Johann Moritz von Nassau-Siegen |
| Stimmen der Väter und Mütter | |
| 281 | Heiko Wulfert: »Macht« in kirchengeschichtlichen Quellen der Neuzeit |
| 90 Jahre Evangelische Michaelsbruderschaft | |
| 291 | Frank Lilie: Mein Leben als Bruder |
| 298 | Hermann Michael Niemann: Michaelsbruderschaft im Norden der DDR |
| 304 | Reinhold Fritz: Michaelsbruderschaft in der DDR |
| 308 | Florian Herrmann: Spüren, was man glaubt. Erfahrungen in der Evangelischen Michaelsbruderschaft |
| 314 | Michaela Bräuninger: Die Evangelische Michaelsbruderschaft und die Geschichte der deutschen Frauenordination: Zwischen Innovation und Restauration |
| Rezensionen | |
| 322 | Heiko Wulfert: Klaus Heinrich Neuhoff, Gott alles in allem (1 Kor 15,28). Theosis, Anakephalaiosis und Apokatastasis nach Maximos dem Bekenner in ihrer Bedeutung für die Kosmische Christologie Jahrhunderten |
| 324 | Horst Scheffler: Dörfler-Dierken, Angelika (Hg.), Reformation und Militär. Wege und Irrwege in fünf |
| 327 | Roger Mielke: Michael Welker, Zum Bild Gottes. Eine Anthropologie des Geistes |
| 330 | Adressen |
| 331 | Impressum |
Macht
von Roger Mielke
Foto: Rolf Gerlach
Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht!
Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die
Wurzel Davids, aufzutun das Buch und seine sieben Siegel.
Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Wesen
und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen,
wie geschlachtet; es hatte sieben Hörner und sieben Augen,
das sind die sieben Geister Gottes, gesandt in alle Lande.
Offenbarung 5,5.6
Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder,
und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter
euch nicht; sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer
Diener sein; und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller
Knecht sein.
Markus 10,42 – 44
Machtfragen
Gab es sie jemals, die ruhigen Zeiten? Zeiten, in denen die Machtfrage geklärt war oder zumindest geklärt schien? Unsere Zeit ist jedenfalls nicht ruhig. Von einer Krise in die nächste stürzt die Welt. Krisen aber stellen immer die Machtfrage: Wer trifft Entscheidungen? Wer spricht für wen? Wer ist eingeschlossen, wer erfährt sich als ausgeschlossen? In den »Corona-Protesten« ging es um das Gegenüber von individueller Freiheit und staatlicher, am tatsächlichen oder vermeintlichen Gemeinwohl orientierter Politik. Eine der großen Fragen der Gegenwart. Aber insgesamt wirkte die Pandemie eher wie ein Sedativum. Die öffentliche Mobilisierung blieb trotz aller digitalen Verstärkung gering. Im Vorjahr hatten die großen Proteste der »Black Lives Matter«-Bewegung und der jugendlichen »Fridays for Future«-Aktivisten weltweit Millionen Menschen auf die Straßen gebracht. Dabei ging es im Kern um Symbole der Macht: Fahnen wurden eingeholt, Wälder besetzt, Standbilder der Sklaverei und des Kolonialismus gestürzt, von Edward Colston in Bristol bis zu König Leopold II. in Antwerpen. So werden politische Identitäten neu verhandelt.
Erzengel Michael
Kirchen und Gläubige sind Teil dieser Prozesse, oft auch Partei – auf der einen oder der anderen Seite, in Aktion und Reaktion. Sie entrinnen den Machtfragen nicht. Das gilt auch für unsere Berneuchener Gemeinschaften. Bruder Florian Herrmann schreibt in seinem Beitrag in diesem Heft: »Es ist eine Gefahr, sich die Bruderschaft als Nische in der Kirche einzurichten und es sich in ihr gemütlich zu machen – soll man sagen, als liturgischen Trachtenverein? « In der Tat – nichts aber würde dem Geist der Berneuchener weniger entsprechen als sich in ein ästhetisch ansprechendes Gärtchen zurückziehen. In diesem Jahr 2021 gedenken wir der Stiftung der Evangelischen Michaelsbruderschaft vor 90 Jahren. Die Stifterbrüder wählten den Erzengel Michael als Leitbild und Patron. Damit war auch für die erste Generation der Brüder die Machtfrage gestellt. Leidenschaftlich nahm diese Generation Anteil an den Auseinandersetzungen und Debatten der 1920er und frühen 1930er Jahre. Michael, der Engelfürst, steht emblematisch für den Kampf und Sieg Gottes gegen die Mächte der Finsternis. Reichlich klirrend kommt die apokalyptische Metaphorik für unser heutiges Lebensgefühl um die Ecke. Sie bedarf einer gehörigen Portion Ironie, um falsche Identifikationen zu brechen. Und doch ist mit ihr Entscheidendes und Unverzichtbares ausgesprochen. Zunächst als Frage: Wem dienst du im Leben und im Sterben? Woher empfängst Du Ziel und Inhalt Deines Lebens? Wie entgehst Du dem narkotisierenden Übermaß, der rasenden Geschwindigkeit, der Dauerkommunikation? Mit einem Wort: Wie gewinnst Du den »Ernst« wieder? Mit Blick auf diese Zusammenhänge sprachen die Väter und Mütter vom »Geistlichen Kampf«.
Bilder der Macht: Löwe und Lamm
Nun bedarf das kriegerische Bild der Macht einer Interpretation durch die Christus-Gestalt. In Offenbarung 5 erscheint der erhöhte Christus in der charakteristischen Doppelgestalt als »Löwe von Juda« und als das »geschlachtete Lamm«. Der »Löwe« als der Sieger über Sünde, Tod und Teufel hat die Macht, das versiegelte Buch der Geschichte zu öffnen – im doppelten Sinne dessen, dass Er die Geschichte auf ihr Ziel und Ende zuführt und dass Er lehrt die Zeichen der Zeit zu sehen und zu verstehen. Immer bleibt der Löwe zugleich das geschlachtete Lamm, erkennbar an den Kreuzeswunden. Das Böse und der Böse wird durch leidende Liebe überwunden, nicht durch »Heer oder Kraft« (Sacharja 4,6).
So ist es nicht unter euch
Macht ist unausweichlich – wo immer kollektiv bindende Entscheidungen gefällt werden müssen. Macht gehört zur Signatur der Zeit des Politischen, der Zeit zwischen der Himmelfahrt und der Wiederkunft Christi. Dem Evangelium wohnt aber das Wissen um die tiefen Ambivalenzen der Macht inne. Auf die Bitte der Zebedaiden in Markus 10 par. um einen privilegierten Platz im Reich Gottes antwortet Jesus mit diesem unerhört machtkritischen Impuls: »So ist es nicht unter euch … «. Nicht etwa »so soll es nicht unter euch sein«, vielmehr »so ist es nicht«. Jesus stiftet unter den Seinen eine andere Ordnung als diejenige der Selbstdurchsetzung im Kampf um knappe Ressourcen. Mit dieser Intervention Jesu verbindet sich eine besondere Gestalt von Führung. In einem gegenwärtigen Managementkonzept spricht man von »servant leadership«, genau darum geht es. In der Gemeinschaft der Jesusleute werden keine narzisstischen Führungsfiguren gebraucht, die sich von der Verehrung, dem Beifall und der emotionalen Zuwendung der ihnen Anvertrauten ernähren. Die Einsicht in diese Gefährdungen und Ambivalenzen ist vielleicht der wichtigste Dienst, den die Kirche in der politischen Arena leisten kann, auch wenn sie dies im Blick auf ihre eigenen Verfehlungen und Missstände nicht anders als in tiefer Demut tun kann.
Reifen an den eigenen Möglichkeiten und Grenzen
Aufschlussreich auch, dass Jesus es den Söhnen des Zebedäus nicht verwehrt, ihren Machtwunsch zu artikulieren. Er weiß um Gründe und Abgründe des Herzens, in dem Aggression, Eifersucht und Rangkämpfe ihren Ort haben. Die guten Plätze sind und bleiben knapp unter den Bedingungen der vergehenden Welt. Zerstörerisch wirken die Machtphantasien besonders dort, wo sie unerkannt und unbenannt bleiben. Dort kann der eigene Wunsch und Willen verdeckt, aber umso ungebrochener, im Mittelpunkt stehen. Dem entspricht symmetrisch die gegenläufige Fehlform: Den Zugang zu den dunklen und hellen Wünschen und Phantasien des Herzens verloren zu haben. Machtversessenheit und Machtvergessenheit sind untergründig verwandt. Im Spiegel dieser Erzählung des Evangeliums wird mit der Machtfrage einer der wesentlichen Prozesse des geistlichen Lebens angerührt: In der Begegnung mit Jesus kommt der eigene Wille ans Licht – und er wird gebrochen. So wie der Lichtstrahl durch das Prisma gebrochen und in seine unterschiedlichen Farben zerlegt wird. Was klar erkannt und ausgesprochen wird, kann dann gereinigt und neu ausgerichtet werden. Genau dies geschieht in Markus 10, wo Jesus die Machtphantasien aller Einzelnen und die Dynamik der ganzen Gemeinschaft auf den Weg des Dienens umlenkt. So betrachtet ist Dienen nicht einfach Unterwerfung, sondern Verwandlung zum Selbst-Sein, Reifen in der Auseinandersetzung mit den eigenen Phantasien, Möglichkeiten und Grenzen – letztlich in der Perspektive des eigenen Sterbenmüssens. Geistliche Prozesse dieser Art haben auch eine eigene politische Dynamik. Erfahrungsgesättigt und mit Blick auf die eigenen Schatten in die Unruhe der Zeit hineinsprechen zu können, darin könnte der Dienst der Kirche am Politischen bestehen, und wiederum der Dienst der Berneuchener Gemeinschaften an der Kirche. Das geht allerdings nicht aus einer Haltung ängstlicher Defensive, sondern nur in der Teilhabe an den Wandlungsprozessen, nur in der Präsenz, nicht im Rückzug.
Ihr Roger Mielke

Foto:
Ehimetalor Akhere Unuabona on Unsplash
Macht und Ohnmacht – eine teure Münze
von Ralph G. Schöne
Weil Obrigkeiten notwendig sind, hat es sie immer gegeben. Aber weil nur die Phantasie gerade diese oder jene Form der Macht bestimmt, ist sie niemals von Dauer, sondern dem Wandel unterworfen.
(Blaise Pascal, 1623 – 1662)
Problematische Macht
Macht als ein soziales Phänomen weist auf seine anthropologische Wurzel, denn sie tritt zwischen Kreaturen, Pflanzen und Tieren und – vor allem zwischen – Menschen auf. Ihre Diversität und Interdependenzen lassen unterschiedliche Verhältnisbestimmungen natürlich erscheinen. In Abhängigkeiten und freiwilligen Kontakten und Zuordnungen werden Machtgefälle und unterschiedliche Machtgrade deutlich. Der Mensch als Gemeinschaftswesen (zoon politikon) kommt nicht ohne Ordnung der ihn betreffenden Dinge aus, auch wenn sich das im Einzelnen und für verschiedene Gruppengrößen in Orientierung und Bedeutung unterschiedlich ausgestalten kann. Diese Dauerherausforderung und -aufgabe wird allgemein Politik genannt (auch wenn das Wort polis auf das Gemeinwesen der Stadt zielt). Deshalb konnte sie Napoleon Bonaparte leicht »unser Schicksal« nennen. Für Friedrich Nietzsche (1844 – 1900) war »alles Leben Wille zur Macht«. Sie ist wesentliches Gestaltungsmittel und mithin omnipräsent. Gewöhnlich wird sie im Singular genannt, tritt aber doch im konkurrierenden Plural auf. Zu den Mächten, die gezielt am Werke sind, treten noch die Gewalten auf, die eher machtvoll als Naturgewalten und wild operierende Kräfte, nicht selten sinnlos roh, so doch ohne Vernunft walten. Der Apostel Paulus ergänzt in seinem Aufweis Christi als Ersten in Schöpfung und Auferweckung, dass »in ihm alles geschaffen ist, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und Unsichtbare, es seien Throne und Herrschaften oder Mächte und Gewalten« (Kol 1,16). Auch wenn es in der modernen politischen Theorie, im Ansatz der sogenannten Vertragstheorien, scheinen könnte, als ob man eine Gesellschaftsordnung völlig neu konstruieren könnte, ist das Bibelzitat ein deutlicher Hinweis auf tradierte Ordnungsformen, die gewachsen sind aus einzelnen Gruppen und Familien, aus der Schöpfungsordnung und Kräfteverhältnissen, aus Nützlichkeitsabw.gungen und -erfahrungen. Quellen der Macht ergeben sich nicht zuletzt aus den Bedürfnissen und Notwendigkeiten, eben jene Mängel zu beheben.
Macht ist somit nicht nur eine Lebensäußerung, sondern Lebensbedingung wie Atmen und Nahrungsaufnahme. Dieser Zusammenhang liegt der geläufigen Rede vom »Machthunger« zugrunde, wenn das Streben nach Macht übertrieben wird. Der Macht haftet etwas Religiöses an, denn in ihrem Sinnhorizont gehört sie ganz notwendig zum Menschen und damit letztlich zu seinem Heil, so dass sie als mysterium tremendum et fascinans (Rudolf Ottos Beschreibung der Erfahrung von Heiligkeit, 1917) wahrgenommen werden kann. Fasziniert, erschreckt und staunend wird über politische Ereignisse und Personen in Geschichte und Gegenwart philosophiert, gerade wenn sie verändernd gewirkt haben. Bis in die Neuzeit wurde Macht von Gottes Allmacht hergeleitet, Staaten – insbesondere die islamischen noch heute – waren theokratisch begründet, auch wenn neben dem monarchischen Prinzip (1845, Friedrich Julius Stahl, 1802 – 1861) mit der athenischen Demokratie ein Ergänzungs- und Konkurrenzmodell gegeben war. Legitimitätsquelle der Macht mit ihrer unentbehrlichen Integrationsfunktion ist ein Sinnhorizont einer vorgegebenen Weltordnung, die dem Gemeinwohl zu dienen hat, die Lehre und Feier als Religion oder säkular die Weltanschauung/ Ideologie.1 Mit dem Gestaltungswillen, der sich in der Schaffung von Ämtern und Institutionen verstetigend ausdrückt, und dem Recht als Handlungsrahmen sind die drei Wurzeln der Politik benannt, die aufeinander bezogen sind:2 Macht, Gestaltung und Recht. Macht ohne Recht ist Willkür, ohne Gestalt Eigennutz; Gestaltung ohne Macht nicht durchführbar und ohne Recht chaotisch bis zur Tyrannis, Recht ohne Gestaltung bloßer Vorsatz und ohne Macht nicht exekutierbar. Wahrhaftigkeit, Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität stehen dabei als Grund(werte) und Abgrund im Spannungsverhältnis zur Macht.3
Die Liebe zur Macht und die Liebe zur Freiheit sind in einem ewigen Widerstreit. Wo die wenigste Freiheit ist, da ist die Leidenschaft für die Macht am brennendsten und gewissenlosesten.
(John Stuart Mill, 1806 – 1873)
Die Theorien von Macht4 und Gewalt5 zielen nicht zuletzt aufgrund geschichtlicher Erfahrung auf deren Beherrschbarkeit und Einhegung. Aber auch die menschliche Natur ist grundsätzlich durch Macht verführbar. Der schlechte Ruf der Macht ergibt sich aus ihrem Missbrauch. Der Verdacht der Herrschsucht, die Neigung zu Manipulation, zur Vermehrung, Häufung und Verstetigung sowie die Gefahr der Sucht, Schaffung von Abhängigkeiten, Vorteilsnahme, Ausreizen zu Machtdemonstrationen von Demütigungen bis Existenzgefährdungen führten historisch zur Theorie der Gewaltenteilung in Legislative, Exekutive und Judikative (Montesquieu, Vom Geist der Gesetze, 1748) und sorgen für latentes Misstrauen in der Politik. Neben Religion und Politik ist die Wirtschaft ein Großfeld der Wirksamkeit von Macht. Aber auch hier gebieten Vernunft und Erfahrung Regeln der Kooperation. Für den Erfinder der Sozialpartnerschaft, des Mitbestimmungsrechts, den Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung (1965 – 69) Hans Katzer (1919 – 1996) war sein Leitmotto wegweisend: »Wer auf dem Markt Macht hat, darf nicht frei sein!«. Macht bedarf der (Selbst-)Bindung. Auch im Privaten ist der Macht nicht alles erlaubt. Überall soll die Würde des Menschen unantastbar sein, und Umwelt- und Tierrechte formulieren Eigenrechte. Nicht zuletzt ist neben den Grundrechten in der Verfassung festgelegt, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht (Volkssouveränität; GG Art. 20,2).6 Auch das Vereinsrecht ist auf Gemeinschaft angelegt. So etabliert sich der Gedanke der verliehenen Macht auf Zeit. Sie ist begrenzt auf einen Amtsträger, der verantwortlich ist und gemacht werden kann. Das bedarf auf menschlicher Seite der Haltung der Demut im Gegenüber zum Übermut, der gewaltsam von der Macht Gebrauch macht. Falsch wäre aber auch die gegensätzliche Einstellung, Macht zu (ver-)meiden oder sie zu dämonisieren oder zu verteufeln. Bis in die Nachkriegszeit des letzten Jahrhunderts war das Ablehnungsdiktum des Schweizer Kulturhistorikers Jakob Burkhardt (1818 – 1897), dass die Macht böse sei (Weltgeschichtliche Betrachtungen, 1905) ein der Zeitgeschichte geschuldetes populäres Thema. Macht gibt es aber nicht an sich. Alle Beteiligten tragen Mitverantwortung. Heute ist es Konsens, dass es darauf ankommt, von der Macht richtigen Gebrauch zu machen. Sie genau definitorisch zu fassen, scheint nicht zu gelingen.
Ich gebe zu, dass in der Macht ein Element des Bösen steckt. Aber das Gute, das wir in ihr suchen, ist ohne jenes Böse nicht zu haben.
(Marcus Tullius Cicero, 106 – 43 v. Chr.)
Immer noch bezieht sich wissenschaftliche Betrachtung auf die Definition des Altmeisters der deutschen Soziologie, Max Weber: »Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance beruht.«7 Ein dezidierter Neuansatz ergänzt eine positiv akzeptierte Wirkweise: neben der »power over« die »power to«, neben der auf Herrschaft und Gehorsam ausgerichteten die Gestaltungsmacht, quasi die sachliche zur personalen Seite.8 Letztlich ist sie allein aus Gewissensgründen und Bürgersinn zu rechtfertigen.9
Macht der Ohnmächtigen
Trotz der Notwendigkeit des Machtgebrauchs gab und gibt es die Erfahrung, ihr absolut ausgeliefert zu sein. Nach den neutestamentlichen Zeugnissen – heute als anachronistisch verstanden – gibt es aber kein Widerstandsrecht gegenüber dem Bösen (vgl. z. B. Mt 5,39, unwidersprochenen Sklavenstand u. a.), da die frühen Christen mit dem nahen Ende und dem Anfang eines neuen Äons rechneten. Weil die von den ersten Christen erwartete baldige Wiederkunft Christi ausblieb, akzeptierte die Kirche den weltlichen Machthandel bis hin zur späten Bejahung des Mitwirkens. Die einst völlig bedeutungs- und machtlosen Christen sehen sich nach ihrem jahrhundertelangen dominanten Einfluss heute – wie andere Zeitgenossen auch, zumal im pluralistischen Staat – in anderer Weise wieder machtlos gegenüber politischen Entwicklungen. Im Massenzeitalter, in der Globalisierung und angesichts der digitalen Datenflut erscheint der Einzelne ohnmächtig. Die Verantwortungs- und Machtdelegierung, die in der Demokratie durch Wahlen und Abstimmungen erfolgen, ja, die Politik überhaupt, werden tendenziell immer komplizierter und damit undurchschaubarer. Der sog. Wutbürger verschärft die Lage durch Protestverhalten und Verweigerung, an Entscheidungen mitzuwirken. Die Versuchungen der vermeintlichen Ohnmacht10 drücken sich im Ohne-mich-Standpunkt aus, in Populismus und Demagogie bis hin zu gewalttätigen Konsequenzen, in milderer Form in Desinteresse und Wahlenthaltung mit der Folge der Beförderung autoritativen Gefahren – vor denen vor nicht allzu langer Zeit schon Ralf Dahrendorf (1929 – 2009), prophetisch gewarnt hatte. Gegenstrategie sind Transparenz und Erleichterung von Beteiligungsmöglichkeiten, Einforderung von gegenseitigem Respekt, Suche nach Kompromissen und der Wettstreit der Ideen. 11 Bei Nutzung der eigenen Freiheit und Möglichkeiten können zeit- und umständebedingt selbst eher repräsentative Ämter12 machtvoll werden. Realismus in der Politik sieht die Macht in den Ideen13, im Wissen (Bacon), in der Rhetorik, der Geographie14, den Raum- und Zeitumständen bis hin zum berühmten »Zeitgeist« mit der Macht der Nachrichten und Bilder. Dazu kommen die Macht der Symbolik, des Geldes und der Korruption, der Vernunft und Emotionen, der Intrige15 sowie der Diplomatie, des Wortes (und des Arguments), des politischen Streits, der Lüge und der Persönlichkeit. 16 »Die Offene Gesellschaft« (Karl R. Popper, 1902 – 1994) übt sich in Versuch und Irrtum und im Be- und Widerlegen. Dabei ist der Einzelne grundsätzlich eher weniger wirkmächtig, da in der Demokratie Mehrheitsentscheidungen getroffen werden. Aber auch die Opposition hat in der Demokratie die Möglichkeit, den regelkonformen (öffentlichen) Diskurs – zumal mit den Möglichkeiten von Internet und sog. sozialen Massenmedienformaten – zu beeinflussen, was auch ständig und bewusst in Wahlkämpfen versucht wird.17 Machthäufung fußt auf Überzeugung und Vertrauensvorschuss, verschleißt und kann durch Enttäuschung und Fehler sowie mangelnde Positionierungen verloren gehen.18
Es ist eine seltsame Begierde, nach Macht zu streben und seine Freiheit darüber einzubü.en oder nach Macht über andere zu streben und die Herrschaft über sich selbst zu verlieren.
(Francis Bacon, 1561 – 1626)
Was aber machen die ohnmächtigen Opfer der Macht, die gar einer Politik der Demütigung (Frevert) unterzogen wurden, was diejenigen, die sie selbst verspielt haben und deren Mandat ausläuft? Trotz rechtlicher Möglichkeiten und Versuchen neu anzufangen, sind Diskriminierungen, Ächtungen, Ignoranz, Rufschädigungen und andere Nachteile nicht selten, wie ebenso Karriereverläufe unfreiwillig enden.19 Die Macht ist übergriffig oder dahin und auf andere übergegangen. Das bedeutet aber für die, die das Nachsehen haben, nicht automatisch, keine Machtmöglichkeiten mehr zu haben. Die Rolle hat sich verändert, die Verhältnisbestimmung ist neu geworden. Die neue Situation eröffnet anderes zeitliches und kräftemäßiges Engagement als Opposition, um Einfluss und Macht wieder zu erlangen. Die Lage mag als »noch nie so ernst« empfunden werden: das Leben geht weiter, und man zollt ihm mit kleinerer Münze seinen Tribut. Macht hat so oder so ihren Preis, wie sie auch im Auge der Betrachter gewägt und eingeschätzt wird. Die meisten Menschen sind machtpolitische Leichtgewichte. Nur diejenigen haben die Chance, politische Schwergewichte zu werden und Macht und Einfluss zu gewinnen, die sich über Autorität, Ideenreichtum und Kreativität auszeichnen können, die über kommunikative, finanzielle und auch körperliche Potenz verfügen, die Gefolgschaft finden und in Netzwerken bündeln. So können sie womöglich ihre mediale und sonstige aufmerksamkeitwirksame Präsenz steigern. Das aber verlangt Charakterstärke, schier enervierende Mühe und Geduld, Ausdauer, kurzfristige Taktik und länger angelegte Strategien. Dazu gehört ständige Evaluation, Geistesgegenwärtigkeit für den Kairos und die Intuition aus langjährigen Erfahrungen, nicht zuletzt Menschenkenntnis und möglichst ausgebreitete Sachkenntnisse. Überraschungen bleiben nicht aus, aber trotz mancher Machttechniken und -fähigkeiten ist der Politik – nach alter Erkenntnis – nichts Menschliches fremd, denn letztlich wird Politik ja von Menschen gemacht. Ohne Mut und andere Tugenden ist weder die Macht zu erhalten noch die Ohnmacht auszuhalten. Auch Ohnmacht ist eine Strategie, die Duld- und Enthaltsamkeit der »engagierten Beobachter« – nach Dahrendorf: der Intellektuellen, die darin eine eigene Rolle finden. Aber dies schützt nicht vor den Auswirkungen der Macht, um die ein beständiger Kampf tobt, den man wiederum nur durch Engagement beeinflussen kann.
Die Einstellung gegenüber der Macht sollte die gleiche sein, wie die Einstellung gegenüber dem Feuer. Weder halte dich nicht zu nahe, damit du dich nicht verbrennst, noch weit entfernt, damit du nicht erfrierst.«
(Diogenes von Sinope, um 400 – 323 v. Chr.)
Gemeinsam kann man stärker sein, aber auch schwach. Die Politik hat vielerlei Aporien und Paradoxien zu bieten, nicht zuletzt, dass es eine Macht der Ohnmacht gibt. Am Beispiel der Bundeskanzlerin Angela Merkel lässt sich aktuell aufzeigen, dass sie in ihrem Amt eine auf die eigene Partei(enfamilie) reduzierte Richtlinienkompetenz in der Regelfolge einer Koalitionsregierung hat. Sie verfügte in ihrer Partei über keine sog. Hausmacht, führte eher präsidial und wurde wohl deswegen national wie international als vermeintlich mächtigste Frau der Welt (US-Magazin Forbes) wahrgenommen, weil sie »die Interessen der anderen Machtlosen am besten kommuniziert und moderiert«, also Macht anders organisiert, asymmetrisch mobilisiert und depotenziert, also sogar entmachtend geführt hat.20 Haben als hätte man nicht – die stärkste Macht ist diejenige, die sich nicht verausgaben muss. Sie muss versuchen, ihre Unabhängigkeit zu wahren, auch wenn sie auf geprüftes Wissen und Augenmaß im Blick auf die strategischen Ziele beruht. Den Erfolg kann man anbahnen, aber nur selten erkaufen, auch wenn Opferbereitschaft erforderlich ist und sich Machtanteile verzehren. Herrschaft im Sinne von potestas (vs. violentia) ist vorläufig und »ein weltlich Ding« (Luther).21 Sie gelingt säkular gesprochen mit Glück und darf sich christlich verstanden nur einstellen, wenn man vieles und manches einpreist, nicht zu teuer einfahren muss und sich von Gottes Segen abhängig weiß. Jesus von Nazareth wurde einmal gefragt, ob man Steuern entrichten müsse. Er ließ sich eine Drachme zeigen und antwortete mit Blick auf die der Münze eingeprägten Hoheitszeichen: »Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gott gehört.« (Mt 22, 15–22 par, hier: 21b). Die irdische Macht hat ihr Eigenrecht und ihre Spielregeln, muss sich aber vor einer höheren Instanz verantworten, vor der wir alle ohnmächtig dastehen und als Schuldner der Vergebung bedürftig sind. Wir sind angewiesen auf Nachsicht der Mitmenschen und darauf, dass der Allmächtige dasjenige ergänzt und heilt, was wir verfehlt haben.
Jedem, der Macht in irgendeinem Grade besitzt, kann der Gedanke nie lebendig und heilig genug vor dem Sinn schweben, dass er nur ein anvertrautes Gut verwaltet und dass er von seiner Verwaltung der großen Machthaber, dem einstigen Stifter und Herren aller Gesellschaften, ernste Rechenschaft ablegen muss.«
(Edmund Burke, 1729 – 1797)
Weitere Literatur (in Auswahl):
- Arendt, Hannah: Macht und Gewalt, München: R. Piper 1970/ 81993
- Bogner, Alexander: Die Epistemisierung des Politischen. Wie die Macht des Wissens die Demokratie gefährdet, Ditzingen: Ph. Reclam 2021.
- Eckert, Georg / Novy, Leonard / Schwickert, Dominic (Hg.): Zwischen Macht und Ohnmacht. Facetten erfolgreicher Politik, Wiesbaden: Springer 2013.
- Frevert, Ute: Die Politik der Demütigung. Schauplätze von Macht und Ohnmacht, Frankfurt a. M.: S. Fischer 2017.
- Gerhardt, Volker: Art. Macht. I. Philosophisch, TRE 21 (1991) 648 – 652.Greene, Robert: Power. Die 48 Gesetze der Macht, München: dtv 2001 (OT: New York: Viking 1998).
- Guardini, Romano: Die Macht. Versuch einer Wegweisung, Würzburg: Werkbund 1951/ 61965.
- Han, Byung-Chul: Was ist Macht?, Stuttgart: Ph. Reclam 2005.
- Kemper, Peter (Hg.): Opfer der Macht. Müssen Politiker ehrlich sein?, Frankfurt a. M./Leipzig: Insel 1993.
- Kley, Karl-Ludwig / Maizière, Thomas de: Die Kunst guten Führens. Macht in Wirtschaft und Politik, Freiburg/Basel/Wien: Herder 2021.
- Mayer-Tasch, Peter Cornelius: Kleine Philosophie der Macht, Stuttgart: F. Steiner 2018.
- Meier, Dominik / Blum, Christian: Logiken der Macht. Politik und wie man sie beherrscht, Baden-Baden: Tecum 2018.
- Paris, Rainer: Stachel und Speer. Machtstudien, Frankfurt a. M.: suhrkamp 1998.
- Paris, Rainer: Normale Macht. Soziologische Essays, Konstanz: UVK Verlagsges. 2005.
- Paris, Rainer: Der Wille des Einen ist das Tun des Anderen. Aufsätze zur Machttheorie, Weilerswist: Velbrück Wissenschaft 2015.
- Popitz, Heinrich: Phänomene der Macht, Tübingen: Mohr-Siebeck 1986/ 21992.
- Russel, Bertrand: Formen der Macht, Köln: anaconda 2009 (OT: London: Allen&Unwin 1938).
- Schrey, Heinz-Horst: Art. Macht. II. Ethisch: TRE 21 (1991) 652 – 657.
- Zimmerling, Ruth / Martin Schuck: Art. Macht: Ev. Staatslexikon, Stuttgart: Kohlhammer 2006, Sp. 1474 – 1485.
Ralph G. Schöne, geb. 1964,
Bruder im Konvent Mitte-Ost der Evangelischen Michaelsbruderschaft
Politikwissenschaftler
lebt in Berlin.
Fußnoten
1 Otto Heinrich von der Gablentz: Religiöse Legitimation politischer Macht, in: Carl-Joachim Friedrich / Benno Reifenberg (Hg.): Sprache und Politik, FS Dolf Sternberger (60. Geb.), Heidelberg: Lambert Schneider 1968, 165 – 188, hier: 166.
2 Otto Heinrich von der Gablentz: Macht, Gestaltung und Recht – die drei Wurzeln des politischen Denkens, in: Ders.: Der Kampf um die rechte Ordnung. Beiträge zur politischen Wissenschaft, Köln/Opladen: Westdeutscher Verlag 1964, 36 – 58. Dolf Sternberger zielt mit derselben Begrifflichkeit eher auf die drei historisch manifestierten politischen Grundtypen des klassischen, modern-säkularen und des revolutionäreschatologischen Staates mit Bezug auf Aristoteles, Machiavelli und Marx und Augustinus, in: Drei Wurzeln der Politik, Frankfurt a. M.: Insel 1978.
3 Dolf Sternberger: Grund und Abgrund der Macht. Über Legitimität von Regierungen, Frankfurt a. M.: Insel 1962. 4 Andreas Anter: Theorien der Macht zur Einführung, Hamburg: Junius 2012/ 52020.
5 Teresa Koloma Beck/Klaus Schlichte: Theorien der Gewalt zur Einführung, Hamburg: Junius 2014/ 32020.
6 Gewalt ist hier habituell verstandene, konzentrierte, ja monopolisierte und akzeptierte Macht.
7 Max Weber: Wirtschaft und Gesellschaft. Grundrisse der verstehenden Soziologie, Tübingen: Mohr 1921/ 51972, 28.
8 Gerhard Göhler, Art. Macht, in: Ders./Mattias Iser/Ina Kerner (Hg.): Politische Theorie.
9 Reinhold Schneider: Macht und Gnade. Gestalten, Bilder und Werte in der Geschichte, Wiesbaden: Insel 1946, (7-)17.
10 Otto Heinrich von der Gablentz: Macht die Macht böse? Vortrag in Arbeitsgruppe 3 des [3. Deutschen] Evangelischen Kirchentages 12.7.51 (sc.in Berlin), masch. (6 Seiten), nennt vier bezeichnend mit Genießer, Götzendiener, Drückeberger vor der Macht und Machtgehässiger.
11 Von der Gablentz sah mit Blick auf die Kirchentagslosung des Jahres 1951, »Wir sind doch Brüder«, einen Ausweg darin, dass politisch agierende Menschen »einander Brüder werden« und Christus als Warner zur Seite steht: »Macht ist keine neutrale Möglichkeit des Menschen, sondern ein ungeheures Wagnis, wo dem Demütigen Gottes Engel zur Seite steht und der Hochmütige, der sich den Mächten des Bösen ausliefert, die beste Sache verdirbt, wenn er sie willkürlich vertritt.« (5). Reinhold Schneider betont die Macht des Sakramentalen bzw. die Verpflichtung aus seiner Kraft heraus zu handeln (Anm. 9, 294 – 298, hier: 298).
12 Z.B. das des Bundespräsidenten. Vgl. Karl-Rudolf Korte: Gesichter der Macht. Über die Gestaltungspotenziale des Bundespräsidenten, Frankfurt a. M./New York: Campus 2019.
13 Vgl. Isaiah Berlin: Die Macht der Ideen, Henry Hardy (Hg.), Berlin: Berlin Verlag 2006, insb. 235 – 279.
14 Tim Marshall: Die Macht der Geographie. Wie sich Weltpolitik anhand von 10 Karten erklären lässt, München: dtv 2017/ 102018 = London: Elliot&Thompson 2015.
15 Vgl. Peter von Matt: Die Intrige. Theorie und Praxis der Hinterlist, München/Wien: Carl Hanser 2006.
16 Letztere Quellen wurden in der phoenix-plus-TV-Reihe »Instrumente der Macht« von Kathrin Augustin und Sven Thomsen in jeweils 30-minütigen Beiträgen exemplifiziert.
17 Vgl. z. B. Ludger Helms: Politische Opposition. Theorie und Praxis in westlichen Regierungssystemen, Opladen: Leske + Budrich 2002.
18 Vgl. dazu als Bsp. das aktuelljournalistische Buch von Robin Alexander: Machtverfall. Merkels Ende und das Drama der deutschen Politik. Ein Report, München: Siedler- Random House 2021.
19 Weitere Film-Dokumentationshinweise (jeweils 45 Min.): Schlachtfeld Politik – die finstere Seite der Macht, von Stephan Lamby, NDR 2012; Politik. Macht. Sucht, von Jürgen Leinemann, SWR 2016; Geld. Macht. Politik – Die Volksvertreter und der Druck der Lobbys, von Julia Lehmann und Tobias Seeger, SR 2021; Vom Wort zur Tat? Die Macht der Sprache, von Liz Wieskerstrauch, MDR 2021.
20 Alexander Grau: Macht der Ohnmacht, in: Cicero. Magazin für politische Kultur, Berlin: Respublica Verlag, 13. Jg. H. Nov. 2017.
21 Antonius H. J. Gunneweg / Walter Schmithals: Herrschaft, Stuttgart/Berlin/ Köln/ Mainz: W. Kohlhammer 1980, und dazu: Walter Schmithals: Die gesellschaftliche Verantwortung der Kirche und der Christen und das Problem der Macht, in: Ders.: Jesus Christus in der Verkündigung der Kirche. Aktuelle Beiträge zum notwendigen Streit um Jesus, Neukirchen-Vluyn: Neukirchener 1972, 144 – 168.
22 umkämpf te Begriffe zur Einführung, Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften
Mein Leben als Bruder
von Frank Lilie
Ohne die Bruderschaft wäre ich nicht der, der ich bin. Nun gilt das auch für andere Lebensfacetten, für meine Ehe etwa, für mein Studium, für meine Herkunft. Was zeichnet das Leben als Bruder aus? Ich schaue auf die Stationen einer Berneuchener Reise.
In meiner Ausgabe der Regel der evangelischen Michaelsbruderschaft steht die handschriftliche Notiz »Am 9. Okt. 1993, dem Tag der Aufnahme in die Probezeit, im Mittagsgebet anläßlich des Michaelsfestes in Reinberg überreicht«. 1995 wurde ich in Hofgeismar voll in die Bruderschaft aufgenommen. 1996 übertrug mir der Rat der Bruderschaft auf Vorschlag von Br. Jürgen Boeckh hin die Schriftleitung von QUATEMBER, die ich 2004 an Br. Horst Folkers weitergegeben habe. Wegen dieser Aufgabe wurde ich auch in den Rat und in das Kapitel der Bruderschaft berufen. 2004 bat mich der Rat, das Amt des Ältesten als Nachfolger von Br. Reinhold Fritz zu übernehmen. Bis 2013 stand ich der Bruderschaft, dem Rat und dem Kapitel vor − neben meinem Schulpfarramt an der Ursulinenschule in Fritzlar. Nach dieser Zeit arbeitete ich weiter als Besonders erfahrener Bruder (wir haben als Berneuchener schon ein eigentümliches Vokabular − bereits der Schriftleiter für unsere Zeitschrift trägt einen Titel, der auch in dunkler Zeit verwendet worden ist) in Rat und Kapitel mit beratender Stimme bis 2020 weiter. Mein eigener hessischer Konvent bat mich, im Konventsrat die Aufgabe des Probemeisters auszuüben. Und im August 2021 soll ich nun Geistlicher Leiter des Berneuchener Hauses Kloster Kirchberg werden.
Das sind die äußeren Daten meiner bruderschaftlichen Biographie. Zu ihr gehören auch noch kaum mehr zählbare Konvente, Michaelsfeste, Nachbarschaftstreffen, Stundengebete, Messen und andere Gottesdienste, Meditationen, häusliche Gebetszeiten, Ansprachen, Aufsätze und Artikel, Telefonate, Briefe und Gespräche. Andere können ähnliche Berneuchener Lebensläufe vorweisen. Darf ich mit ihnen sagen, dass die Bruderschaft ein essentieller Teil meiner selbst ist? Sie hat tief in mein Leben (und das, darf nicht vergessen werden, meiner Familie) hineingewirkt. Ich habe mich prägen lassen. Aus einer Entscheidung wurde ein Habitus.
»Und, wie hast Du Gott erfahren?«
Bruder werden
Warum mache ich das? Salopp gefragt: Warum tue ich mir das an? Warum widme ich der Bruderschaft mehr Zeit als manchen anderen Bereichen meines Lebens? Indem ich die Fragen aufschreibe, merke ich, dass sie sich mir so nie gestellt haben. Brudersein ist offensichtlich kein Steckenpferd, das auch durch ein anderes ersetzt werden könnte. Es durchdringt meinen Alltag, tränkt ihn, ja, imprägniert ihn gleichsam. Wie konnte es dazu kommen?
Der Rückblick zeigt mir, dass dies mit Menschen zusammenhängt. Das ist eigentlich keine besonders tiefgreifende Erkenntnis. Aber es waren die Begegnungen mit mich überzeugenden Personen mit einer überzeugenden Lebensweise, die ihr Christsein in Formen gestalteten, die ich als lebenswert erfuhr. Die eigene geistliche Biographie hängt immer mit anderen geistlichen Biographien zusammen. Angelesenes oder Theologisches würde nicht in diese Schichten reichen, die einige Brüder anzurühren wussten, ohne dass sie das so beabsichtigt haben. Ich kenne etliche Brüder, die zur Bruderschaft gefunden haben, weil sie sich vom gottesdienstlichen Leben angezogen fühlten. Und ganz gewiss ist diese nach außen am besten erkennbare Seite der Bruderschaft mit dafür verantwortlich, dass ich am Konventsleben teilzunehmen begann. Wir lebten einige Jahre des Studiums und dann des Vikariates im Schatten der Marburger Universitätskirche. Es blieb gar nicht aus, dort der Evangelischen Messe zu begegnen. Aber das war, meine ich mich zu erinnern, nicht entscheidend. Es waren tatsächlich Menschen, Brüder, die mich auf eine schlichte und tiefe Weise zugleich ansprachen. Bei einer Rundreise durch den Schwarzwald kam ich auch auf den Kirchberg und wurde dort so herzlich begrüßt und aufgenommen, wie ich das als Tagesgast in diesem großen Haus eigentlich nicht erwarten konnte. In Marburg war es Br. Paul Schwarz, dessen ökumenischer Lebenslauf mich tief beeindruckte. Und dann, bei einer Bibelarbeit anlässlich eines Konventes, fragte mich Br. Gerhard Glüder ganz unvermutet: »Und, wie hast Du Gott erfahren?« Der kluge ältere Herr stellte mir, dem jungen Pfarrer, eine schlichte Frage. Er wollte mich nicht belehren, sondern war neugierig auf mich. Bislang war ich es gewohnt, dass Zusammenkünfte mit Verantwortlichen im kirchlichen Raum Sachfragen gewidmet waren. Und Pfarrkonferenzen waren, ich muss es leider so formulieren, oftmals Jahrmärkte der Eitelkeit. Mittlerweile weiß ich auch, dass die Bruderschaft davon nicht frei ist, nicht sein kann. Aber geistliche Gespräche, wie sie mir hier begegneten, habe ich sonst in der Kirche nicht führen können.
Zu DDRZeiten kursierte ein Witz, der die Abhängigkeit von der Besatzungsmacht thematisierte: »Frage: Warum ist die Sowjetunion unser Brudervolk? Antwort: Freunde kann man sich aussuchen, Brüder nicht.« Das stimmt für die Bruderschaft nur bedingt. Denn diese Brüder habe ich mir ja ausgesucht. Die »Achtung und Liebe«, von der bei der Aufnahme die Rede ist, ist gewiss unterschiedlich verteilt. Und, ja, auch dies, es entstehen immer wieder Freundschaften zwischen Brüdern. Warum auch nicht? Aber Bruderschaft ist eben auch eine bewusst eingegangene Bindung, die über das emotionale Moment der Freundschaft hinausführt. Dieser bewusste Schritt der Selbstbindung soll ja gerade über die Tiefen und Untiefen der Emotionalität hinwegtragen. Auch wenn das manche Brüder für sehr weitgehend halten, ist dieses Versprechen der Bindung zumindest strukturell dem Eheversprechen vergleichbar. Im Regelsatz 19 wird die Bruderschaft mit der Familie (und, ja, zeitbedingt auch mit dem Volk) als Aufgabe und Verpflichtung in einem Zusammenhang genannt. Das ist ein hoher Anspruch, der auch in der Aufnahme in die Bruderschaft ausdrücklich formuliert wird.
Denn die Bruderschaft zählt sich zu den geistlichen Gemeinschaften, deren Mitglied man nur durch einen förmlichen Schritt werden kann. Die Teilnahme am Konventsleben, die Probezeit, die Teilnahme an der Bruderschaftswoche und die Zustimmung erst des Kapitels und dann der Gesamtbruderschaft zum Aufnahmegesuch sind die Hürden, die vor der Vollaufnahme aufgebaut stehen. In einem Gottesdienst fragt der Älteste: »Meine Brüder. Ihr habt beschlossen, N.N. in den Konvent der Brüder aufzunehmen. Seid ihr bereit, ihn als Brüder zu achten und zu lieben, ihn mit eurer Fürbitte zu begleiten und ihm mit Rat und Tat beizustehen, so sprecht: Ja, wir sind bereit.« Die Brüder respondieren: »Ja, wir sind bereit.« Darauf erfolgt dann die Selbstverpflichtung des neuen Bruders:
»Vor Gott gelobe ich euch, meinen Brüdern: Ich füge mich gehorsam ein in die Ordnung der Bruderschaft zum Dienst an der Kirche. Ich will den Brüdern in Achtung und Liebe zugetan sein.«
Bruder sein
Bindung durch Selbstverpflichtung an eine Gruppe, die ihrerseits ihre Bereitschaft zur Bindung signalisiert hat − diese wechselseitige Verbindlichkeitserklärung bildet das Fundament des bruderschaftlichen Zusammenlebens. Denn gerade das entsteht durch diese Verpflichtung und ihre Umsetzung im Konventsleben: Eine spezifische Form des Zusammenlebens. Ich habe mich bewusst an eine Gruppe von Menschen gebunden − genauer: an eine Gruppe von Männern. Und umgekehrt bindet sich diese Gruppe an mich. Wilhelm Stählin hat über Bruderschaften im Allgemeinen (also in der Kirchengeschichte) und die Evangelische Michaelsbruderschaft im Besonderen gesagt, dass sich hier die Selbstbindung Gottes in Jesus Christus spiegele. Eigentlich ist die ganze Kirche zum Leben in Geschwisterschaft berufen, nämlich dazu, dass in ihrer Gestalt die Zuwendung Gottes in Christus erkennbar werden solle. Weil ihr das als Gemeinschaft der (begnadigten) Sünder nicht in Reinheit möglich sein kann und weil dies auch Konfessionskirchen, Gemeinden und Pfarreien überfordern würde, braucht es Geschwisterschaften als exemplarische Formen der Einübung in das Vertrauen auf Gottes Zuwendung zu uns. Der Anspruch wird nicht geringer − bleibt aber lebbar, wenn wir Einübung in das Vertrauen beim Worte nehmen. Wer übt, wird Fehler machen. Wer lebt, wird ohnehin Fehler machen. Aber nur wer mitlebt, wird das Verzeihen lernen. Er wird es lernen müssen, weil er sonst sich und den anderen das Fundament der Gemeinsamkeit entzieht.
Die Bruderschaft hat bestimmte Formen des ›Zusammenlebens entwickelt‹ die in einem Wechsel von ritualisierten und freien Zeiten Ermöglichungsspielräume bieten. Auch oder gerade dies hat zur Ausbildung eines Typus geführt − zumindest höre ich das ab und an (Außenstehende haben dafür doch manchmal den besseren Blick). Das Brudersein prägt den Bruder. Und es kann ja auch gar nicht anders sein, als dass im Laufe der Jahre (»Einübung«!) die Grundentscheidung für die Bruderschaft Auswirkungen auf uns hat. Freilich ist es auch so, dass die Bruderschaft ihre Anziehung auf bestimmte Männer ausübt. Aber zunächst ist sie Gemeinschaft, d. h. sie stellt einen Lebenszusammenhang zur Verfügung − mit eigenen Regeln und Verbindlichkeiten. Es zeigt sich wieder einmal, dass Freiheit kein abstrakter Begriff ist, sondern geregelte Ermöglichung des Zusammenlebens. Ich bin immer nur in Relation zu anderen und zu anderem – und meine Freiheit besteht darin, dies zu sehen und zu gestalten. Die Bruderschaft ist eine Form der Weisen, wie das Verhältnis zu Christus gestaltet werden kann.
Bruder bleiben
In der Regel ist davon die Rede, dass die Bruderschaft sich »Arbeitsaufgaben« gestellt hat. Dabei fällt auf, dass dieser Abschnitt erst als Teil VII folgt (Satz 48–55). Bei einer Freundschaft oder einer Liebesbeziehung kämen wir nicht auf den Einfall, nach ihrem Zweck zu fragen. Dort ist es gerade umgekehrt: Liebe und Freundschaft entziehen sich jeglicher Verzweckung! Ich sehe hier durchaus Analogien zum Brudersein. Zuerst nach der Aufgabe einer Bruderschaft zu fragen, verfehlt ihren tieferen Sinn als Lebensgemeinschaft. Der Sportverein hat ein klares Ziel, nämlich die Ermöglichung bestimmter Sportarten. Das werden wir so für die Bruderschaft nicht formulieren können. Wilhelm Stählin hat seinerzeit kritisch-spöttelnd bemerkt, manchmal könnte die Bruderschaft wie eine Vereinigung zur Durchsetzung komplizierter liturgischer Regeln wirken. Damit hat er zumindest eine Gefährdung benannt. Die Regel setzt aber gar nicht mit den Gottesdiensten oder liturgischen Erfindungen der Bruderschaft ein, sondern mit einem Abschnitt über das Gebet. Bruderschaft ist organisierte Gebetsgemeinschaft. Und selbst hier kommt nicht sogleich eine Gebetsintention in den Blick, sondern es geht zunächst um die pädagogische Arbeit an sich selbst. Der Bruder »gibt sich Gott aufs neue hin«, er »übt in Treue und Gehorsam das tägliche Gebet« und »bittet darum, daß sein ganzes Sein und Wesen durchdrungen werde von der heiligen Gegenwart des Höchsten« (Satz 1 und 2). Brudersein und Heiligung werden hier in einen engen Zusammenhang gebracht: Hingabe an Gott − und zwar immer wieder erneut als tägliche Übung − wird zur Beschreibung dessen, was Gebet sein kann. Hier ist wichtig, dass es nicht um das Was des Betens geht, sondern um das Dass! Der Zweck des Gebetes liegt in sich selbst, es ist Hörens-Gewissheit (und nicht Erhörungs-Gewissheit; s. Frank Lilie, Hörens-Gewissheit. Philosophische Überlegungen zum Beten, Sankt Ottilien 2019).
Aber warum braucht es dafür eine Gemeinschaft? Wir werden hier zwei Gründe nennen müssen. Zum einen spiegelt sich in der geistlichen Gesellung der Ursprung unseres Glaubens. Wir glauben nicht aus uns selbst heraus, sondern weil andere dies vor uns getan haben. Ich kann mich nicht selbst taufen, ich kann mir nicht selbst die Schuld vergeben, ich kann mich nicht selbst trösten. Dies braucht den Blick des anderen, es muss mir gesagt werden. Und dafür sind, zum zweiten, Mitchristen notwendig, glaubensnotwendig, Menschen, die mich begleiten und mir diese Begleitung versprochen haben. Dies ist eine weitere Nuance von Verbindlichkeit: Wir versprechen einander Begleitung − so, wie Christus uns begleiten will. Weil ich Mitchristen habe, kann ich ahnen, dass Christus mit mir ist. Und Christus ist mit mir, weil ich Mitchristen habe. Um dies zu gestalten und immer wieder neu einzuüben, brauchen wir geistliche Gemeinschaften, die sich verabreden und verpflichten und zu dieser Verabredung und Verpflichtung stehen.
Es gibt Gemeinschaften, die auch räumlich zusammenleben (aus der benediktinischen Tradition stammt der Begriff der stabilitas loci, der Bindung der Schwester oder des Bruders an ein bestimmtes Kloster). Wir nennen sie meist Kommunitäten. Pointiert können wir sagen: Die stabilitas loci der Michaelsbruderschaft vollzieht sich in den Konventen und imKonventsleben.
 Zu den Besonderheiten der Michaelsbruderschaft gehört es, dass sie sich bewusst an Männer wendet. So wie es Gemeinschaften gibt, die sich nur Frauen öffnen oder auch Frauen und Männern zusammen, so muss es auch reine Männergruppen geben. Denn Männer haben frömmigkeitsgeschichtlich einen großen Nachholbedarf in geistlicher Gesprächskultur, weil ihnen über Jahrhunderte hinweg abtrainiert worden ist, über ihr Innenleben zu reden. Bruderschaft kann ein geschützter Raum des Austausches sein, in dem die geschlechtliche Polarität nicht im Vordergrund steht. Dies geschieht in der Michaelsbruderschaft in den sogenannten geschlossenen Konventen. Sie sind, weil die meisten der anderen Konventsveranstaltungen bewusst öffentlich sind, die Existenzgrundlage der Bruderschaft als Bruderschaft neben dem Helferamt, der geistlichen Begleitung des einen durch den anderen Bruder.
Zu den Besonderheiten der Michaelsbruderschaft gehört es, dass sie sich bewusst an Männer wendet. So wie es Gemeinschaften gibt, die sich nur Frauen öffnen oder auch Frauen und Männern zusammen, so muss es auch reine Männergruppen geben. Denn Männer haben frömmigkeitsgeschichtlich einen großen Nachholbedarf in geistlicher Gesprächskultur, weil ihnen über Jahrhunderte hinweg abtrainiert worden ist, über ihr Innenleben zu reden. Bruderschaft kann ein geschützter Raum des Austausches sein, in dem die geschlechtliche Polarität nicht im Vordergrund steht. Dies geschieht in der Michaelsbruderschaft in den sogenannten geschlossenen Konventen. Sie sind, weil die meisten der anderen Konventsveranstaltungen bewusst öffentlich sind, die Existenzgrundlage der Bruderschaft als Bruderschaft neben dem Helferamt, der geistlichen Begleitung des einen durch den anderen Bruder.
Nur in diesem Zusammenhang mit der geistlichen Selbstschulung des Michaelsbruders kann, ja darf von den Aufgaben der Bruderschaft gesprochen werden. Nur so, als Aufforderung zur Arbeit an sich selbst, ist der Satz aus der Gründungsurkunde zu verstehen: »Wir können an der Kirche nur bauen, wenn wir selber Kirche sind.« Kritik an der Kirche muss bei mir einsetzen! Was tue ich? Bin ich bereit, das freundliche Gesicht der Kirche zu sein? In der Bruderschaft geht es immer wieder um Verleiblichung. Dieses große Wort erinnert uns daran, dass jede Lehre gelebt werden will, wenn sie nicht nutzlos zwischen Buchdeckeln vor sich hin dämmern möchte. Die schlichte Frage von Bruder Glüder ist es, die ich mir immer wieder stellen möchte: Und, wie hast Du Gott erfahren? Bruderschaft ist ein Versuch, darauf eine Antwort zu geben.
Es war die Bruderschaft, die mich zum regelmäßigen Gebet geführt hat. In der Bruderschaft habe ich die ersten Meditationen erlebt. Und ich habe mit der Bruderschaft Gottesdienste gefeiert, bei denen mir das Herz aufging. Die Bruderschaft hat die Weise beeinflusst, wie ich Kirchen betrete und wie ich Gottesdienst feiere. Man muss es erlebt haben, wie eine Kirche voller Menschen miteinander schweigt und zur Stille kommt. Ich habe den Wert der Form erfahren. Während ich dies schreibe (im Januar 2021), hält uns das Corona-Virus noch in seinem Griff. Wie gut, dass es Formen des Gebets gibt, die uns tragen. Freilich, die Entscheidung der Bruderschaft für den Anschluss an die abendländische altkirchliche Tradition mit dem gregorianischen Stundengebet und der Messe als Grundform des Gottesdienstes wird nicht von jedem als Befreiung empfunden. Aber das ist auch gar nicht notwendig. Es darf doch Vielfalt geben. Wir sollten in der Liturgie bloß stets wissen, was und warum wir was tun. Formbewusstsein bedeutet lediglich, dass ich mich nicht allein vor Gott weiß und sehr bewusst auf die Tradition zurückgreife, die ja Ausdruck von gelebter Frömmigkeit ist. Wie gut tut es in den Tagen des Lockdown, sich auf eine liturgisch geprägte Sprache stützen zu dürfen, ja geradezu in sie hineinzufallen wie in die offenen Arme Christi! Immer sind die anderen da, von denen ich weiß, dass sie mit mir in gleicher Weise vor Gott stehen oder gestanden haben. Traditionsverbundenheit bedeutet immer Vergegenwärtigung.
Nur in der kleinen übersichtlichen Gruppe einer Geschwisterschaft kann ich mich öffnen, nur hier wage ich Kritik und kann Kritik an mir so formuliert werden, dass ich mich verstanden weiß. Wenn es geistliche Gemeinschaften nicht gäbe, müssten sie dringend ins Leben gerufen werden. Wir brauchen sie als fromme Spielwiesen, als Übungsplätze der Kirche, als ökumenische Freibeuter und spirituelle Grenzverletzer. Wir brauchen sie, um Häresien wagen zu können und um Formen zu erproben. Sie sind wichtig, weil hier Versuche gewagt werden, die andernorts vielleicht als frech oder auch anmaßend gelten. Ob Geschwisterschaften eine Zukunft haben? Die fromme Antwort sagt: Das weiß Gott allein. Die mutige Antwort sagt: Die Kirchen werden sie dringend benötigen. Und meine eigene Antwort sagt: Ohne die Bruderschaft wäre ich nicht der, der ich bin.
Pfarrer Dr. Frank Lilie, geb. 1960,
ist Geistlicher Leiter des Berneuchener Hauses Kloster Kirchberg.
Die Evangelische Michaelsbruderschaft und die Geschichte der deutschen Frauenordination: Zwischen Innovation und Restauration
von Michaela Bräuninger
Einer der nachhaltigsten und umstrittensten Umbrüche im Protestantismus nach 1945 war sicherlich die schrittweise Gleichstellung der Frauen im Pfarramt – mit Elisabeth Haseloff wurde 1959 in Lübeck die erste Frau ins Pfarramt berufen. Dies gelang hauptsächlich dank der Evangelischen Michaelsbruderschaft, die für Außenstehende nicht unbedingt als Ausgangspunkt des Feminismus gilt.1 Wie kam es zu diesem erstaunlichen Schritt?
Für die Beantwortung dieser Frage hilft es, die Biografie Elisabeth Haseloffs (1914–1974) zu betrachten:
Elisabeth Haseloff war die Tochter einer Malerin und eines Kunsthistorikers. Als Mädchen nahm sie begeistert an den Aktivitäten der bündischen Jugend teil, in der ja auch Gründungsväter der Bruderschaft wie Bruno Meyer oder Gerhard Langmaack tätig waren. Die Theologiestudentin Haseloff wurde bereits zu Studienbeginn im Jahr 1935/1936 Mitglied der Bekennenden Kirche Schleswig-Holsteins. Sie war in ihrer Kieler Studienkohorte die einzige Studentin, und knüpfte im Auftrag ihrer Kommilitonen den Kontakt zum schleswig-holsteinischen Bruderrat – erstere konnten diesen Mut nicht aufbringen.
Elisabeth Haseloff legte 1939 ihr Erstes Theologisches Examen ab, 1943 wurde sie in Münster promoviert, und zwar mit der Arbeit »Christologie der neutestamentlichen Abendmahlstexte«. Die Dissertation wurde von dem Kieler Michaelsbruder Heinz-Dietrich Wendland betreut, mit dem Haseloff nicht nur zeitlebens freundschaftlich verbunden blieb. Es war Wendland, der Haseloff für die Liturgie der Bruderschaft begeisterte. Und es war Haseloff, die sich während Wendlands Kriegsgefangenschaft um dessen Familie kümmerte. Als der Ethiker durch seine Sehbehinderung immer eingeschränkter war, verfasste sie zudem in seinem Namen Aufsätze und Vorträge. Elisabeth Haseloff war 1939 die erste schleswig-holsteinische Theologin, die den Weg ins Pfarramt anstrebte. Folglich verfügte ihre Landeskirche noch über keine Vikarinnengesetze, und es musste eine spezifische Regelung gefunden werden. Dies gelang. Haseloff begann ihre praktische Ausbildung in der Kirchengemeinde Rendsburg-Neuwerk, Sprengel Schleswig. Ihr Vikarsvater Hans Treplin hielt viel von ihr. Er ließ sie predigen, obschon Frauen zu dieser Zeit lediglich Bibelarbcheiten und die seelsorgerliche Betreuung von Mädchen und Frauen gestattet war. Treplin traute Haseloff ebenfalls zu, die zahlreichen vakanten Gemeinden in Rendsburg und Umgebung zu betreuen. Am 28.09.1941 wurde Elisabeth Haseloff in der Christkirchengemeinde Rendsburg-Neuwerk von ihrem ehemaligen Ausbilder zur Vikarin eingesegnet. Sie wurde nicht ordiniert, aber selbst für die Einsegnung der Vikarin Haseloff gab es zu diesem Zeitpunkt noch keine rechtliche Grundlage. Doch das kümmerte bis 1945 nicht, und Haseloffs Arbeitsbereiche, ihre Leistung ohnehin, entsprachen völlig denen ihrer ordinierten Amtsbrüder. Hinsichtlich ihrer kirchenpolitischen Haltung blieb die Theologin sich treu, sie stand »im Mustergau Nordmark« und inmitten »Deutscher Christen« zu Wort und Bekenntnis. Ihre Streitigkeiten mit dem nationalsozialistischen Bürgermeister brachten sie mehrfach in Gestapohaft, ihre Landeskirche stand ihr dabei nicht unterstützend zur Seite.
Nach Kriegsende hatte sich die Kirchenleitung Schleswig-Holsteins – wie alle anderen Landeskirchen auch – mit der Vikarinnenfrage zu befassen. Das heißt, es ging darum, ob Frauen für das Pfarramt ordiniert werden sollten und konnten, oder ob es biblisch und kirchenrechtlich geboten sei, sie als ledige Vikarinnen ausschließlich für den Dienst an Frauen und Kindern einzusegnen. Das Amt sui generis, also das »Amt besonderer Art«, war eigens für Frauen konzipiert worden. Sie wurden dafür nicht ordiniert, durften keine Sakramente verteilen, nicht predigen und wurden statt als »Pastorin« als »Vikarin« bezeichnet. Dafür hatten sie dieselben Studienleistungen wie Männer zu erbringen, bekamen lediglich 80 Prozent des Gehalts eines unverheirateten Pastors, und mussten zölibatär leben.
Hinsichtlich der Vikarinnenfrage kam es zu keiner kirchlichen Einigung. Elisabeth Haseloff wurde dennoch am 1. Oktober 1945 widerruflich das Rendsburger Amt anvertraut, ihre anderen norddeutschen Amtsschwestern hatten das Gemeindeamt zu verlassen. Die Pastoren kamen sukzessive vom Krieg zurück, die Pfarrer aus den ehemaligen Ostprovinzen des Reiches mussten ebenfalls mit einem Amt versorgt werden. Folglich konnten die Kirchen auf ihre stille Reserve wieder verzichten, will heißen: auf die Frauen. Dass Elisabeth Haseloff weiterhin als eingesegnete Vikarin das volle Pfarramt versehen durfte, lag an der Intervention ihres väterlichen Freundes, des Theologen Heinrich Rendtorff, und dem Engagement ihrer Kirchengemeinde, die sich lautstark vor den beiden schleswig-holsteinischen Bischöfen und im Landeskirchenamt für sie verwendete.
Allerdings blieb es bei einer Anstellung auf Widerruf. Im Herbst 1958 schrieb Haseloff an den holsteinischen Bischof Wilhelm Halfmann: »Schließlich werden Sie, hochverehrter Herr Bischof, es verstehen, daß ich in eine Kirche gehen möchte, die mir die gesetzliche Grundlage für meine Arbeit gibt.« Und so nahm sie das Angebot des lübischen Bischofs Heinrich Meyer an, in seiner Landeskirche als ordinierte Pastorin nicht nur die gesamte Frauenund Mütterarbeit zu übernehmen, sondern zudem auch noch in Lübeck, St. Matthäi den Predigtdienst und die Sakramentsverwaltung zu versehen – und all das mit den entsprechenden gesetzlichen Grundlagen.
Soweit die biographischen Stationen der eingesegneten Vikarin Elisabeth Haseloff in Schleswig-Holstein. Wie konnte die Theologin nun in Lübeck zur ersten deutschen Pastorin im Sinne der Kirchengesetze werden? Und was hatte es mit der Intervention der Michaelsbruderschaft auf sich?
In ihrem Lebenslauf für die Bewerbung an der Lübecker Kirche schrieb Haseloff: »Persönlich bin ich in meiner Amtszeit sehr stark durch nahe Beziehungen zu einigen Gliedern der Michaelsbruderschaft gefördert worden. Dadurch hat sich mir vor allem ein tieferes Verständnis des Gottesdienstes und des sakramentalen Lebens der Kirche erschlossen, so daß mir der Gottesdienst – und zwar der Gottesdienst einer wirklich mitfeiernden Gemeinde mit Wort und Sakrament – das eigentliche Ziel des Gemeindeaufbaues war.«
Elisabeth Haseloff war dank ihres Doktorvaters die Bruderschaft ja wohlbekannt, sie stand während der Kriegsgefangenschaft Wendlands im engen Briefkontakt mit dessen Mitbrüdern Rudolf Spieker und Wilhelm Stählin. Haseloff hielt die Brüder über den Verbleib Wendlands auf dem Laufenden. Da dessen Familie in den ersten Nachkriegsmonaten in großer finanzieller Not war, bat sie die Brüder erfolgreich um Unterstützung. Der Lübecker Senior Bruno Meyer wiederum und Heinz-Dietrich Wendland waren nicht nur Michaelsbrüder, beide zehrten auch zeitlebens von den frühen Begegnungen mit dem sozial engagierten Theologen Friedrich Siegmund Schultze und der durch ihn begründeten Berliner »Sozialen Arbeitsgemeinschaft Ost« (SAG). Außerdem war Haseloff nach Ende des Zweiten Weltkrieges für den Ökumenischen Rat der Kirchen mit Stählin im engen Austausch über die Frage der Frauenordination. Der ÖRK versendete nämlich Fragebögen an seine Mitgliedskirchen. Dies geschah unter dem Eindruck des Krieges, und der Tatsache, dass etliche Kirchen rassistischen und antisemitischen Ideologien mehr als aufgeschlossen gegenüber standen. Es ging darum, die Shoa zum Anlass zu nehmen, eine geschwisterlichere Kirche zu gestalten. Konkreter: Die Mitgliedskirchen sollten sich zur »Frauenfrage« äußern. Dies taten Haseloff und Stählin, und berichteten dem ÖRK von der Berneuchener Bewegung, in der Frauen und Männer gleichberechtigt über die Neugestaltung der Kirche diskutiert hatten.
Soweit also die kleine Netzwerkanalyse, die erklärt, warum Haseloff in ihrer schleswig-holsteinischen Heimatkirche erläuterte, sie sei durch nahe Beziehungen zu einigen Gliedern der Michaelsbruderschaft gefördert worden.
Bruno Meyer beriet sich 1958 mit seinem Helfer und Mitbruder, dem Hamburger Pastor Rudolf Spieker, über die Einrichtung einer vollen Pastorinnenstelle für Lübeck. Die beiden waren sich einig: Man wollte ein Pastorinnengesetz erlassen und das Amt Elisabeth Haseloff überantworten. Rudolf Spieker wusste um die kirchliche und theologische Selbstständigkeit von Frauen, schließlich hatte er bereits die Schwestern von Ordo Pacis und der Cella St. Hildegard bei ihrer Gründung beraten. Das war alles andere als leicht. Die Schwestern kämpften zwanzig Jahre lang dafür, von der Mehrheit der Michaelsbruderschaft nicht als Tochterorden der Bruderschaft wahrgenommen zu werden, der väterlich betreut werden musste. Bruno Meyer wiederum bedauerte noch in den Sechzigerjahren in seinen Memoiren, dass ein erheblicher Teil der Michaelsbruderschaft gegen die Ordination von Frauen sei. »[…] aber glücklicherweise doch nicht alle; z. B. tritt der bekannte Neutestamentler und jetzige Sozialethiker in Münster, Br. Prof. D. Wendland entschieden für das Amt der Pastorin ein.«
Der Lübecker Bischof Heinrich Meyer konnte augenscheinlich von seinem Senior Bruno Meyer von Elisabeth Haseloff überzeugt werden. Dies war ein mutiger Schritt aller Beteiligten – sowohl die Intervention der Brüder, als auch das Engagement des Bischofs. Denn ihnen war gewiss bewusst, dass eine ordinierte Frau ein Fanal für die EKD sein würde. Wie sollte man danach den anderen Theologinnen erklären, dass in Lübeck das Amt der Pastorin möglich war, in anderen Landeskirchen jedoch nicht? Wie gesagt, jetzt ist die Evangelische Michaelsbruderschaft nicht für ihre herausragende Frauenförderung bekannt. Aber die Frauen der Schwesternschaft Ordo Pacis – die Institution war aus den Michaelsbrüdern hervorgegangen – versicherten mir, dass einzelne Brüder, insbesondere nach Ende des Zweiten Weltkriegs sich sehr für »die Sache der Frauen« eingesetzt hätten. Denn sie hätten eben erkannt, mit welcher Fülle und Kompetenz die Frauen während des Krieges ihr Amt ausgefüllt hatten.
Elisabeth Haseloff nahm also das Angebot der Ev.Luth. Kirche Lübecks an, mit den gesetzlichen Grundlagen als ordinierte Pastorin die gesamte Frauenund Mütterarbeit zu übernehmen und zusätzlich in der St. Matthäigemeinde den Predigtdienst und die Sakramentsverwaltung zu versehen. Noch eine Randbemerkung: Das Geistliche Ministerium der Lübecker Kirche traute sich nicht zu, Haseloff zu ordinieren – man befürchtete den Widerstand der VELKD und der EKD. Haseloffs Vikarsvater Treplin, der seine Schülerin eingesegnet hatte, stellte ihr jedoch nachträglich und handschriftlich eine Ordinationsbestätigung aus. Die Verbindung von Wort und Sakrament blieben Pastorin Haseloff ein Anliegen, der Kontakt zu einzelnen Michaelsbrüdern blieb ihr ebenfalls erhalten. Es war also nur folgerichtig, dass sie zusammen mit ihrer Gefährtin Ruth Philippzik Kontakt zu anderen Schwesternschaften aufnahm. Würde es gelingen, in Lübeck eine ähnliche Gemeinschaft wie Ordo Pacis, die der Irenenschwestern oder eben die der Evangelischen Michaelsbruderschaft aufzubauen? Am Ende waren es Bruder Ernst Jansen, der Nachfolger Bruno Meyers im Lübecker Amte, und Rudolf Spieker, die die ersten »Bahrenhof-Schwestern« für die neu gegründete Lübecker Schwesternschaft einsegneten. Wie die Schwestern von Ordo Pacis nabelten sich auch die Lübecker Schwestern schnell von der Bruderschaft ab. Und wie die Schwestern von Ordo Pacis blieb man sich dennoch freundschaftlich verbunden, und lud sich gegenseitig zu den jährlichen Kommunitätstreffen ein.
Zusammenfassend kann festgehalten werden: Die Michaelsbruderschaft war kein Kristallisationspunkt der kirchlichen Frauenbewegung. Insbesondere die württembergischen Brüder hätten es sehr geschätzt, wenn sich Frauen in liturgischen, theologischen und glaubenspraktischen Fragen weiterhin von Männern führen ließen. Gleichwohl waren bereits einzelne Mitglieder der Berneuchener Bewegung, und einige der Gründungsgeneration der Bruderschaft, in der Lage, Frauen nicht als Männern nachgeordnet zu begreifen. Brüder wie Ernst Jansen, Bruno Meyer, Rudolf Spieker, Heinz-Dietrich Wendland – oder, um noch andere zu nennen: Eberhard Eisenberg und Gerhard Langmaack – förderten Frauen und ertüchtigten Frauen offensiv. Vermutlich verhält es sich mit der Evangelischen Michaelsbruderschaft genauso wie mit anderen kirchlichen und profanen Institutionen: Sie schwanken zwischen Innovation und Restauration.
Quellen:
Archiv des ÖRK Genf, Nr. 4321. O1. Bestand Work of Women in the Church. Akte II. Landeskirchliches Archiv Kiel, Bestand 42. O7, Personalakten der Lübecker Pastorinnen und Pastoren, Nr. 156. Personalakte Elisabeth Haseloff. Noch ungeordnetes Archiv der Evangelischen Michaelsbruderschaft. Nachlass Rudolf Spieker. Landesarchiv Schleswig-Holstein, LASH, Bestand 423.1, Religiöse Gemeinschaften. Evangelische Schwesternschaft Ordo Pacis. LASH, Bestand 329. 226, Vorlass Michaela Bräuninger. LASH Bestand 399. 227, Vorlass Ruth Philippzik.
Literatur:
Michaela Bräuninger: [Art.] Freyss, Gertrud Mina Sophie Dr., * 4.7.1904 in Karlsruhe, † 20.11.2007 Berlin; Chemikerin, Mitbegründerin von Ordo Pacis. In: Biographisch Bibliographisches Kirchenlexikon, BBKL, Band XLI Nordhausen 2020, Sp. 384 – 390.
Dies.:[Art.] Haseloff, Elisabeth Agnes Augusta Margarethe Dr., * 30.6.1914 in Rom, † 29.11.1974 in Hamburg. In: Biographisch Bibliographisches Kirchenlexikon Band 40. Hertzberg 2019, 439 – 443.
Dies.: Ordo Pacis. Eine eigensinnige evangelische Schwesternschaft im Gebet. In: Asketische Selbstbeschränkungen und Entgrenzungwsstrategien. Religion – Politik – Geschlecht«. Münster 2021, 143 – 160.
Stefan Grotefeld: Friedrich Siegmund-Schultze: Ein deutscher Ökumeniker und christlicher Pazifist. Gütersloh 1995.
Rainer Hering: Liturgische Form. Die Liturgische Bewegung in den evangelischen Kirchen, In: August H. Leugers-Scherzberg/ Lucia Scherzberg (Hg.): Diskurse über »Form«, »Gestalt« und »Stil« in den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. Saarbrücken 2017 (theologie.geschichte, 9), 259 – 286.
Hannelore Sachse: Esther von Kirchbach (1894 – 1946). »Mutter einer ganzen Landeskirche«. Eine sächsische Pfarrfrau in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Oldenburg 2010.
Beate Schröder /Gerdi Nützel (Hg.): Die Schwester mit der roten Karte. Gespräche mit Frauen aus der Bekennenden Kirche. Berlin 1992.
Heinz-Elmar Tenorth u. a. (Hg.): Friedrich Siegmund-Schultze (1885 – 1969): Ein Leben für Kirche, Wissenschaft und soziale Arbeit. Stuttgart 2007.
Paul Toaspern (Hg.): Arbeiter in Gottes Ernte. Heinrich Rendtorff. Leben und Werk. Berlin 1963.
Heinz Dietrich Wendland u. a. (Hg.): Lebendige Ökumene. Festschrift für Friedrich Siegmund-Schultze zum 80. Geburtstag. Von Freunden und Mitarbeitern. Witten 1965.
Dr. Michaela Bräuninger arbeitet derzeit an ihrem Habilitationsprojekt – einer Frauenkirchengeschichte Nordelbiens. Zuletzt veröffentlichte sie: »Wir gedenken der Frauen, der bekannten wie der namenlosen.« Die Schwesternschaft Ordo Pacis als Beispiel für innerkirchliche Frauenemanzipation. In: Rainer Hering / Manfred Jakubowski-Tiessen (Hg.): »Erinnern, was vergessen ist«. Beiträge zur Kirchen-, Frömmigkeits- und Gendergeschichte. Festschrift für Ruth Albrecht. Husum 2020 (Schriften des Vereins für Schleswig-Holsteinische Kirchengeschichte 64), 254 – 268.