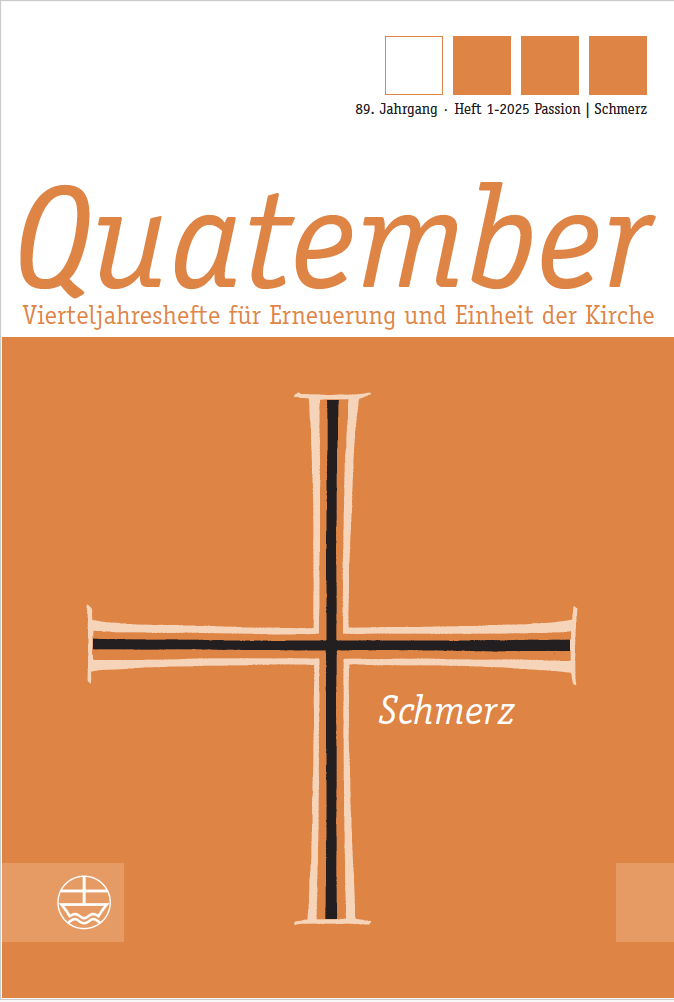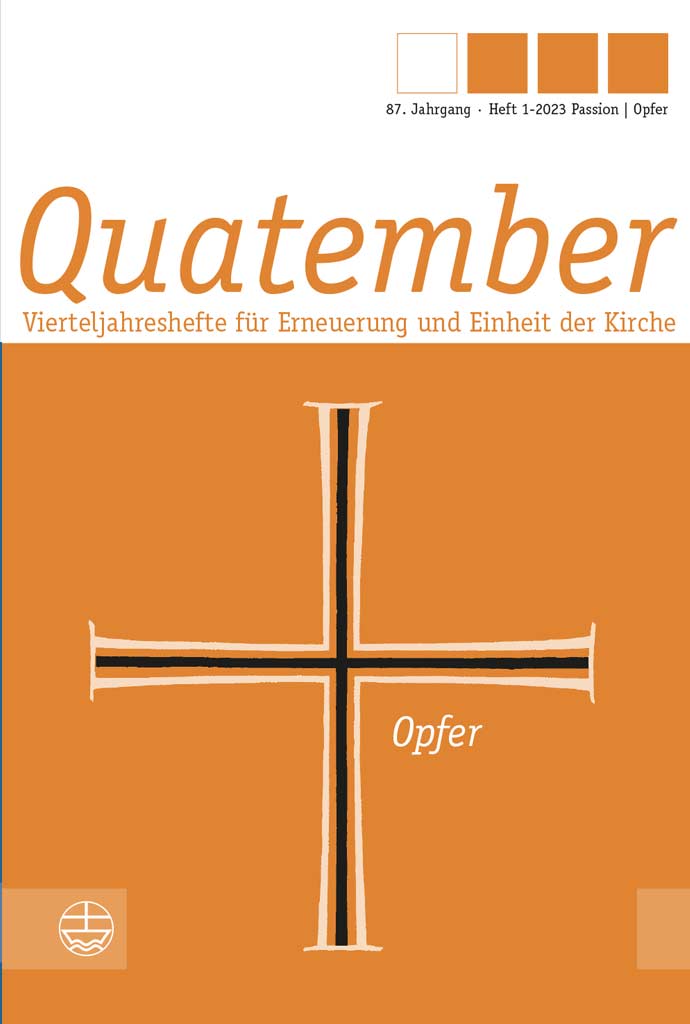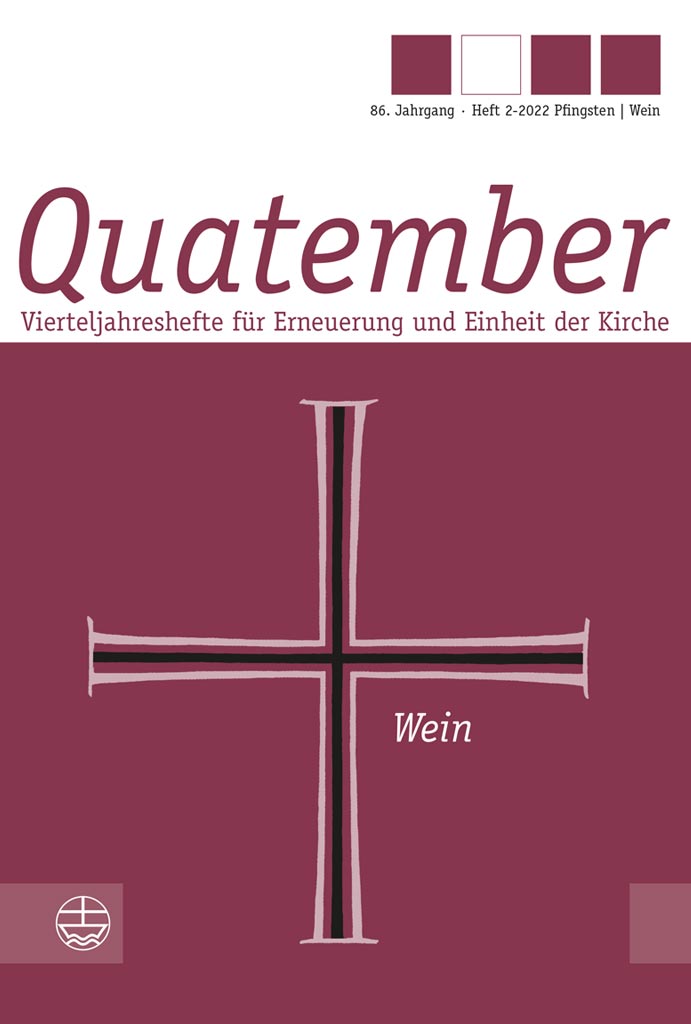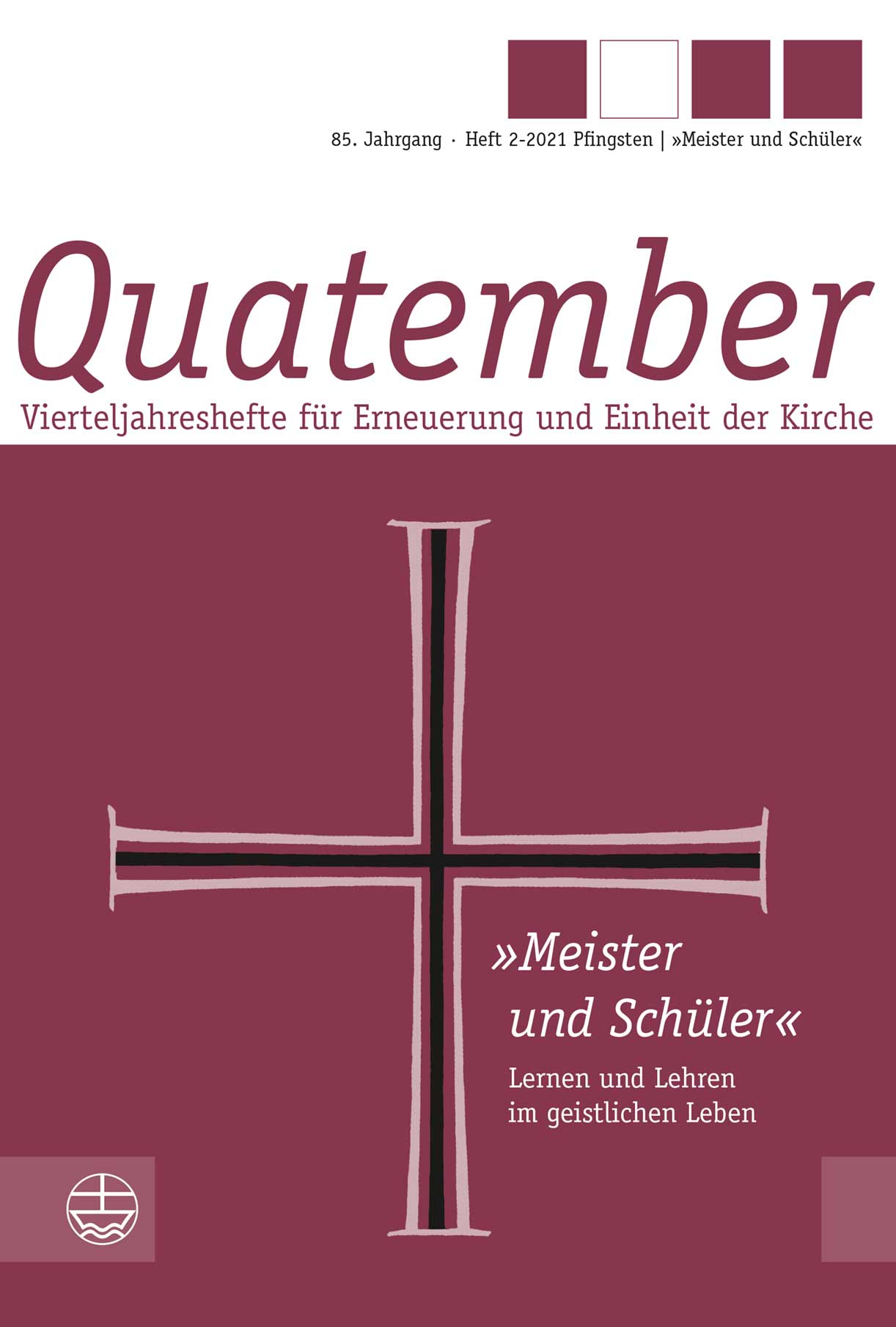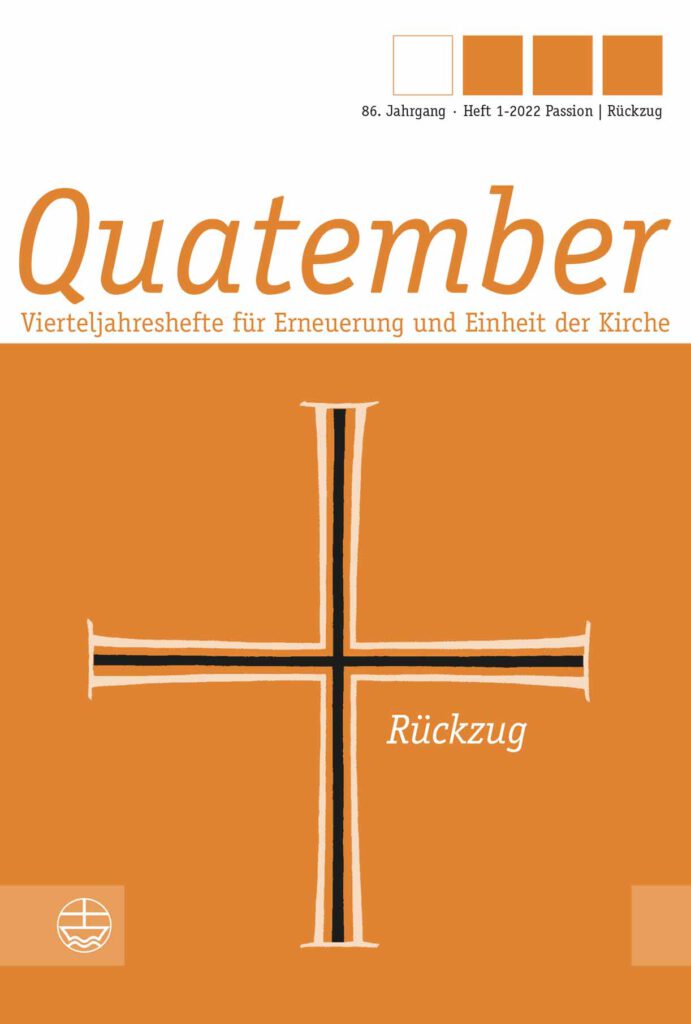
1-2022 | Rückzug
Inhalt
| Zur Einführung | |
| 2 | Roger Mielke: Rückzug |
| Essays | |
| 7 | Andreas Müller: Rückzug in die Wüste?! Die Eremiten im spätantiken Christentum |
| 15 | Namhee Chon und Dr. Roland Wöhrle-Chon: Erde und Himmel berühren – Einzelklausur in Andalusien |
| 24 | Christian Schmidt: Monastische Bausteine |
| 33 | Hartmut Löwe: Wie ich die Teilung Deutschlands und |
| 47 | Stephan Sticherling: Taufvergesslichkeit |
| 55 | Christoph Petau: B, B, B: Bertha von Suttner, Bretagne, Berneuchen. Betrachtungen zum »Gebet des Heiligen Franziskus« |
| Stimmen der Väter und Mütter | |
| 59 | Heiko Wulfert: »Rückzug« als Thema in Quellen aus der geistlichen Tradition |
| Meditation | |
| 70 | Christoph Petau: Geh von den Menschen |
| Rezensionen | |
| 71 | Axel Mersmann: Rüdiger Safranski, Einzeln sein |
| 73 | Roger Mielke: Daniel Schreiber, Allein |
| 75 | Roger Mielke: Henning Theißen, Glaube, Hoffnung, Liebe. Erträge der Theologie für Menschen von heute |
| 79 | Adressen |
| 80 | Impressum |
Rückzug
von Roger Mielke

Foto: Rolf Gerlach
»Nun hat die geschaffene Seele des Menschen auch zwei Augen. Das eine ist das Vermögen, in die Ewigkeit zu schauen, das andere zu sehen in die Zeit und in die Kreaturen, darin Unterschiede zu erkennen […] und dem Leibe Leben zu geben und ihn zu richten und zu regieren. Aber diese zwei Augen der Seele des Menschen vermögen nicht zugleich miteinander ihr Werk zu üben, sondern, soll die Seele mit dem rechten Auge in die Ewigkeit sehen, so muss sich das linke Auge aller seiner Werke entäußern und sich halten, als ob es tot sei.«
Theologia Deutsch (Der Franckforter), 7. Kapitel [1]
The Lake Isle of Innisfree [2]
I will arise and go now, and go to Innisfree,
And a small cabin build there, of clay and wattles made; Nine bean-rows will I have there, a hive for the honey-bee, And live alone in the bee-loud glade.
And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, Dropping from the veils of the morning to where the cricket sings; There midnight’s all a glimmer, and noon a purple glow,
And evening full of the linnet’s wings.
I will arise and go now, for always night and day
I hear lake water lapping with low sounds by the shore; While I stand on the roadway, or on the pavements grey, I hear it in the deep heart’s core.
William Butler Yeats (1892)
Die Seeinsel von Innisfree
Ich werde mich jetzt erheben und nach Innisfree gehen, Dort eine kleine Hütte bauen, aus Lehm und Geflecht gemacht; Neun Reihen Bohnen werde ich dort haben, einen Korb für die Honigbiene,Und allein werde ich dort leben in bienenlauter Lichtung.
Und ich werde dort etwas Frieden haben, denn der Friede sinkt langsam herab Von den Schleiern des Morgens zu dem Ort, an dem die Grille singt; Die Mitternacht ist dort ganz Schimmer, der Mittag violettes Glühen Und der Abend voller Hänflingschwingen.
Ich werde mich jetzt erheben und gehen, denn immer, bei Nacht und Tag, Höre ich das Wasser des Sees leise ans Ufer schlagen; Während ich auf dem Fahrweg stehe oder auf grauem Pflaster, Höre ich es tief im Herzensinnern.
Deutsche Übersetzung von Johannes Beilharz 2021 [3]
Zwei Jahre lang hat uns die Corona-Pandemie in den Rückzug gezwungen. Eigentlich sollte man, so war meine Erwartung für dieses Passions-Heft von »Quatember«, im Frühjahr 2022 mit einem späten Ostertermin, schon nahe an der warmen Jahreszeit gelegen, diese merkwürdige Zeit endlich bilanzieren können. Aber die Verhältnisse sind anders. Kann man anders als in apokalyptischen Bildern sprechen? Nach der Seuche kommt der Krieg:
»dass sie sich untereinander umbrächten« (Offb 6,4).
Jetzt also ist von »Rückzug« in anderem, in militärischem Sinn die Rede. Der Krieg ist zurückgekehrt nach Europa. Und so wie sich zwei Jahre lang die Aufmerksamkeit auf »Inzidenzen« und »R-Werte« richtete, so lernt man nun die Namen der Vorstädte von Kiev und die Orte der ukrainischen Atomkraftwerke. Ganz klar: Ich bin zutiefst beeindruckt vom Mut des ukrainischen Volkes, dem brutalen Angriffskrieg entgegenzutreten, für die politische Selbstbestimmung und Freiheit einzustehen. Wie viele andere haben auch wir eine ukrainische Flüchtlingsfamilie aufgenommen, eine Mutter mit ihrem 11-jährigen Sohn und dem Großvater von 85 Jahren, der sich noch an den Zweiten Weltkrieg erinnern kann. Ihre Geschichte und ihre Erfahrungen schneiden einem ins Herz und wir wünschen dem ukrainischen Volk den größten Erfolg bei der Verteidigung seines Rechts. Und doch dürfen wir dabei nicht stehen bleiben. Im Krieg müssen wir nach dem Frieden fragen, danach, wie Europa nach dieser Konfrontation wieder zu einer Friedensordnung wird zurückkehren können. Der Krieg ist medial allgegenwärtig und setzt sich in den Herzen fest, selbst in den friedliebenden, »postheroischen« Völkern Europas. Die Nachrichten sind voll von gewalttätigen Bildern und nicht minder gewalttätigen Tönen, und die Frage ist, wie die Bilder und Töne weiterwirken und prägen werden.
Gerade hier wird die ursprüngliche Frage nach dem Rückzug noch einmal sehr wichtig. Wie entscheidend ist es, in diesen Tagen und Wochen auch innerlich Abstand zu halten, selbst immer wieder die Stille zu suchen, die Bilder abzutun, eben in den Rückzug zu gehen, um über die Konfrontation hinaus zu denken, so wichtig sie gegenwärtig – und auch künftig – politisch auch sein mag und bestanden werden muss. Gerade dem geistlichen Urteil ist klar: Die Konfrontation betrifft nicht das Letzte, sondern das Vorletzte.
In dieses Suchen spricht das Gedicht von William Butler Yeats hinein, des großen irischen Poeten, der, an der Schwelle zwischen Romantik und Moderne stehend, tief in die Ambivalenzen der Moderne hineingeschaut hat. Im Jahr 1892 schrieb er die drei Strophen über den imaginierten Rückzug von den grauen Asphaltstraßen auf die kleine Insel Innisfree im Lough Gill im Nordwesten Irlands. Das Gedicht lebt von seinen akustischen Eindrücken: Vom Gesumm der Bienen, vom Flattern der Vögel, vom sanften Schlag der Wellen am Strand der Insel. Diese Geräusche sind nur im Rückzug hörbar. Sie sind ein-fach. Es sind andere Geräusche als diejenigen des Krieges und der Auseinandersetzung, andere Geräusche auch als diejenigen der großen und kleinen Städte. Erst der Rückzug macht die elementaren Geräusche der Schöpfung hörbar und öffnet damit auch den inneren Menschen. Wichtig ist hier nicht eine allzu wohlfeile Kulturkritik. Wegweisend ist vielmehr die Frage, aus welcher Quelle die Ordnung des eigenen Lebens und die Ordnung des gemeinschaftlichen Lebens überhaupt geschöpft werden können. Das eine nicht ohne das andere. Diese Frage hat eine zutiefst politische Dimension, sie umfasst auch die Suche nach den Quellen einer künftigen Friedensordnung. Auftrag der Christenheit ist es und bleibt es, für eine solche Friedensordnung einzutreten, selbst aber auch aus den Quellen des Friedens zu schöpfen und zu leben.
Wenn wir uns diesem Auftrag stellen, finden wir im Rückzug keine schiedlich friedliche Idylle. Eine Romantik des Rückzugs ist nicht am Platz. Das wird in diesem Heft besonders deutlich in den Überlegungen von Roland Wöhrle-Chon und Namhee Chon, die ihre Erfahrungen aus der buddhistischen Tradition mitteilen: Kräftig und einfach zugleich. Mehrere Beiträge dieses Heftes beziehen sich auf die Erfahrungen der Wüstenv.ter: Der Essay von Andreas Müller über die Eremiten; die als »Bausteine« zusammengestellten elementaren Überlegungen von Christian Schmidt, aus eigener monastischer Erfahrung geschöpft und in eigenen Aufenthalten in der Wüste bewährt. Auch die Stimmen aus der Kirchengeschichte zum Thema Rückzug, die Heiko Wulfert kommentiert hat, beziehen sich auf die Wüstenv.ter. Diesen geistlichen Grunderfahrungen spürt man ab, dass sie hart errungen sind. Der Rückzug, zumal der Rückzug in die Wüste, ist keine Idylle. Der Rückzug macht überhaupt erst bereit, in rechter Weise in der Welt zu leben und die eigenen Aufgaben wahrzunehmen.
Der Beitrag von Hartmut Löwe über den Zusammenhang der eigenen reichen Lebensgeschichte mit der Teilung Deutschlands nimmt auch die Härte der geschichtlichen Wirklichkeit präzise in den Blick.
Diese Einsicht in den Zusammenhang von Rückzug und Weltzuwendung hat auch eine ekklesiologische Dimension. Die Kirche wird nur die richtige Weise der Weltzuwendung finden, wenn sie aus den Erfahrungen des Rückzugs heraus lebt. Vielleicht gibt es sie sogar, die Einkehrtage, Stillezeiten, Fastenexerzitien nicht nur der Presbyterien und Gemeindekirchenräte, sondern auch der Kirchenleitungen – ich weiß nur nichts davon. Vermutlich ist dies die wichtige Aufgabe der geistlichen Gemeinschaften, daran zu erinnern, es immer wieder vorzuleben, und auch die Theologien zu entwickeln, die diese geistliche Erfahrung reflektieren und kommunizieren. Darauf weist Stephan Sticherling in seinem Beitrag hin.
In dieser Zeit des Krieges, an dem wir in den Ländern der Europäischen Union gegenwärtig (Anfang März 2022) zwar nur mittelbar Anteil haben, der jedoch unsere Wahrnehmungen intensiv prägt, erinnert uns der Beitrag von Christoph Petau zum sogenannten Friedensgebet des Franziskus besonders an den Friedensauftrag der Kirchen.
Hilfreich für die Verhältnisbestimmung zwischen Rückzug und Weltzuwendung finde ich das eindrückliche Bild aus dem spätmittelalterlichen, von Luther so hochgeschätzten mystischen Text der »Deutschen Theologie«, verfasst wohl von einem Deutschordenspriester aus Frankfurt am Main, und deswegen auch »Der Franckforter« genannt. In dem dieser Einführung vorangestellten Zitat ist von den beiden Augen der Seele die Rede. Das eine Auge ist in die Ewigkeit gerichtet und nimmt Anteil am dreieinigen Leben Gottes, das andere Auge ist gerichtet auf die Aufgaben in der vergehenden Welt. Solange der Mensch in seinem Leib lebt, sind beide Augen notwendig. Die Rettung des Menschen oder die »Vergottung«, wie die »Theologia Deutsch« sagt, gelingt allerdings nur durch das eine Auge, das sich auf die ewige Welt Gottes richtet. Es ist wichtig sich die Rangfolge dieser beiden Augen deutlich zu machen. In der Argumentation des mystischen Traktats werden die beiden Augen der Seele in Parallele gesetzt zu den beiden Naturen Christi: der menschlichen und der göttlichen Natur. Getreu dem altkirchlichen Grundsatz von der Enhypostasie der menschlichen Natur Christi ist die göttliche Natur diejenige, die personbildend ist, durch die die Person ihre Form gewinnt. Dieser christologische Grundsatz ist auch ein anthropologischer Grundsatz für den Mystiker: Personbildend für den Menschen ist die Ausrichtung des einen Auges der Seele auf den dreieinigen Gott, um an dessen ewiger Fülle Anteil zu haben. Nichts anderes bedeutet die Metapher des Rückzugs: das Auge der Seele abzuwenden von der Vielfalt der Welt und es in Einfalt hinzuwenden auf den dreieinigen Gott. Aus dieser Quelle heraus allein kann die Rückwendung in die Welt gelingen, ohne dass sich der innere Mensch an die Vielfalt der Bilder und Töne verliert. Die beiden Augen der Seele muss jeder von uns in sich ausbilden und sie in die angemessene, in die rechte Relation stellen.
Ein besonderer Dank für dieses Heft geht an Rolf Gerlach aus Antwerpen, der uns seine visuellen Meditationen zum Rückzug zur Verfügung stellt. Die Frage nach den äußeren und inneren Orten, Häusern, Räumen steht im Mittelpunkt seiner Arbeiten.
Eine inspirierende Lektüre dieses Heftes und eine gelingende Balance zwischen Rückzug und Zuwendung wünscht Ihnen
Ihr Schriftleiter
Roger Mielke
| [1] | Theologia Deutsch (Der Franckforter), übs., hg. und mit einer Einleitung und einer Schlussüberlegung versehen von Alois M. Haas, Freiburg/Br., Einsiedeln: Johannes Verlag, 31980, 48. |
| [2] | Deutsche Übersetzung auf S. 5. |
| [3] | Quelle: http://www.jbeilharz.de/poetas/yeats/. |
Rückzug in die Wüste?! Die Eremiten im spätantiken Christentum
von Andreas Müller
Eremiten – das sind wörtlich übersetzt nichts anderes als Männer und Frauen der Wüste. Die frühen Mönche und Nonnen, die sich nachweislich ab dem 3. Jahrhundert in die Wüsten des östlichen Mittelmeergebiets begaben, werden somit insbesondere durch den Ort bezeichnet, an dem sie wohnten. Auch andere Begriffe für die frühen Asketinnen und Asketen ergeben sich aus der Topographie: Sie werden nämlich auch Anachoreten genannt. Anachoresis meint nichts anderes als Rückzug, Verlassen von gewohnten Strukturen und bewusstes Aufsuchen neuer Lebenswelten, die traditionell mit Ruhe und Einsamkeit (griechisch Hesychia) eng in Verbindung gebracht werden. In der deutschen Sprache werden die frühen Eremiten daher auch häufig als Einsiedlerinnen und Einsiedler bezeichnet. Dieser Begriff trifft allerdings auf die wenigsten der spätantiken Mönche und Nonnen zu. Viele von ihnen zogen sich zwar zurück, aber keineswegs in die absolute Einsamkeit. In der neueren Forschung ist man sich darüber einig, dass die meisten Eremitinnen und Eremiten in einer Art Einsiedlerkolonien zusammenwohnten, oft in einer Behausung, einem Kellion, zusammen mit einem anderen Mönch oder einer anderen Nonne.
In Unterägypten in den Wüsten südlich von Alexandria entstanden so große von Einsiedlern bewohnte Gebiete, nämlich die Sketis, die Nitria und die Kellia. In Palästina versammelten sich die Mönche und gelegentlich auch die Nonnen am Wochenende in Zentren ihrer Siedlungsstruktur, zu den Gottesdiensten in der Kirche, zum Markt, auf dem sie ihre Produkte verkaufen konnten, oder auch zu gemeinsamen Mahlzeiten im Refektorium. Die in Palästina so genannten Lavren, die spezifischen Siedlungsstrukturen, verfügten also über eine ganze Reihe von gemeinsamen Einrichtungen, die die Mönche oder Nonnen an spezifischen Tagen eben auch gemeinsam nutzen konnten. Gelegentlich waren das sogar Institutionen für Gäste oder für Kranke. Selbst in den ab den 20er Jahren des 4. Jahrhunderts entstehenden großen Klöstern, den sogenannten Koinobien (von koinos bios = gemeinsames Leben) wohnten die Mönche oder Nonnen zunächst allein, in ihrer eigenen Zelle. Das Wort Monachos heißt ja wörtlich übersetzt »der Alleinlebende«. Auch wenn z. B. die Pachomianermön che in Oberägypten gemeinsam beteten, arbeiteten und aßen und über gemeinsamen Besitz verfügten, so stellte der Eintritt in ihr Kloster immer auch einen Schritt in die Einsamkeit, wenn auch mit einem gemeinschaftlichen Rahmen dar. Einsamkeit in Gemeinschaft, sei es in Mönchssiedlungen oder auch in einem großen Kloster, war also im frühchristlichen Mönchtum kein Wert an sich. Es ging selbst bei der Anachorese um mehr, als sich einfach nur von der Welt zurückzuziehen. Einsamkeit und Ruhe boten die Möglichkeit zu einem geistlichen Fortschritt und wurden gerade auch deswegen angestrebt. Dabei griffen die Mönche und Nonnen durchaus auf biblische Vorbilder zurück.
Biblische Vorbilder
Die Wüste als Ort der Besinnung und des Weges in das Gelobte Land spielt bekanntlich schon in der Exodus-Erzählung der hebräischen Bibel eine zentrale Rolle – hier konnten die Israeliten entdecken, was in ihrem Herzen ist und ob sie nach Gottes Geboten leben würden oder nicht (vgl. u. a. Dtn 8,2). Eben durch die »Versuchung« in der Wüste und die Zuwendung der Israeliten zu Gott war der Weg ins gelobte Land offen (vgl. Dtn. 8,7 – 9). Im sogenannten Frühjudentum sind Texte wie diese deutliche Zeugen dafür gewesen, dass der Weg durch die Wüste ein Weg der Reinigung gewesen ist. Dementsprechend hat der Philosoph Philo von Alexandrien den Exodus kommentiert: »Nachdem Gott sie also vernünftigerweise von den schädlichen Berührungen in den Städten weg in die Wüste geführt hatte, um ihre Seelen von Fehlern zu reinigen, begann er damit, den Gemütern Nahrung zu reichen.«1 Wie ein Arzt, so Philo, habe Gott die Israeliten von der Welt getrennt, um ihre Krankheit zu entfernen. Schon Elia war in der Wüste sogar Gott begegnet (1 Kön 19,1 – 18), nach Jesaja forderte hier eine Stimme auf, Gott den Weg zu bereiten (vgl. Jes 40,3). An solche Texte knüpften die Evangelien an: Johannes der Täufer forderte eben in der Wüste zu Buße und Umkehr auf, um für das nahe Himmelreich vorbereitet zu sein (vgl. Lk 3,3 – 6). Und Jesus selbst bereitete sich in der Wüste auf sein öffentliches Wirken vor, indem er sich dort zahlreichen Versuchungen aussetzte (vgl. Lk 4,1 – 13). Texte wie diese haben die ersten Mönche ermutigt, radikale Nachfolge Jesu eben in der Wüste zu suchen – so brach z. B. der bekannteste Wüstenvater Antonios, angestachelt durch die Geschichte vom Reichen Jüngling (vgl. Mt 19,21), auf dem Weg zur Vollkommenheit in die Wüste auf. Es ging dabei keineswegs um einen bequemen Ort des Rückzugs, um das angenehme Ganzfür- sich-Sein, sondern um den Weg in die Wüste als Ort des Kampfes und der Auseinandersetzung mit sich und allen Gedanken, die einen in der Einsamkeit überfallen können.
Der Weg in die Wüste als Kampf – Einsamkeit als geistlicher Fortschritt
In den Texten von und der Literatur über die frühen Wüstenv.ter wird die Wüste, die Einsamkeit nie als Ort der Ruhe und Beschaulichkeit beschrieben. Vielmehr handelt es sich bei der Wüste um einen Ort des Kampfes, der Versuchung und der Auseinandersetzung mit dem, was in der spätantiken Literatur oft als Angriff der Dämonen bezeichnet wird. In der Vita Antonii, der von Athanasios von Alexandrien verfassten berühmtesten Lebensbeschreibung eines Eremiten, wird diese Auseinandersetzung anschaulich beschrieben: Zahlreiche innere Gedanken überfielen den Asketen. In der ruhigen Umgebung brach das auf, was in der Geschäftigkeit der Welt verdrängt worden war. Die Gedanken und Dämonen quälten den Wüstenvater nicht nur im Geist, sie bedrängten ihn nach der Erzählung des Athanasios sogar auch in Form von wilden Tieren und hinterließen dabei körperliche Schmerzen (vgl. Athan. V. A. 8). In der Situation der Zurückgezogenheit wurden auch viele Sehnsüchte wach, die dem Einsiedler zuvor nicht bewusst waren. Übersetzt man das Leben aus dem Griechischen genau, dann sind das z. B. nicht nur erotische Sehnsüchte, die durch Frauen, sondern sogar auch solche, die durch Männer geweckt wurden. Einsamkeit führte also – das ist eine immer wieder zu findende Erkenntnis in der Wüstenv.ter-Literatur, keineswegs selbstverständlich zur Seelenruhe. Sie löst ganz im Gegenteil oft vielmehr die intensivsten seelischen Konflikte aus. Sie hilft damit dem Menschen, sich selbst und seine innersten Gedanken zu erkennen und sich mit diesen auseinanderzusetzen.
Anschaulich beschreibt die Wüstenaskese etwa der Kirchenvater Hieronymus in diesem Sinne:
»Als ich in der Wüste weilte …, da schweiften meine Gedanken oft hin zu den Vergnügungsst.tten Roms. Einsam, innerlich verbittert saß ich da. […] Täglich gab es Tränen und Seufzer. Und wenn mich gegen meinen Willen der Schlaf übermannte, streckte ich meine kaum noch zusammenhaltenden Knochen auf den nackten Boden hin. […] Also jener ›Ich‹, der aus Furcht vor der Hölle mich selbst zu einem solchen Kerker verurteilt habe, in der einzigen Gesellschaft von Skorpionen und wilden Tieren, dachte oft zurück an die Tänze der Mädchen. Die Wangen waren bleich vom Fasten, aber im kalten Körper flammte der Geist auf in der Glut der Begierden. […] Ich erinnere mich noch sehr gut, wie ich oft Tag und Nacht ohne Unterbrechung schreiend zubrachte, daß ich nicht eher aufhörte, meine Brust zu schlagen, bis der Herr mich schalt und meine innere Ruhe zurückkehrte. Selbst vor meiner Zelle fürchtete ich mich, da ich in ihr die Mitwisserin meiner Gedanken sah.« 2
Durch die intensive Auseinandersetzung mit den inneren Gedanken und den äußeren Versuchungen vermochten viele Mönche der Wüste, gleichsam zu Seelenärzten zu werden. Sie erstellten ganze Kataloge von Gedanken und Begierden, die von der Konzentration auf das Wesentliche abzulenken schienen. Ein Meister solcher Seelenlehre war Evagrios, der aus dem Pontus stammte und sich letztlich in den Kellia, also einer ägyptischen Wüste niedergelassen hatte. Aus der Beobachtung seiner selbst entwickelte er einen Katalog von acht Lastern. Diese sind allerdings nicht im moralischen Sinne zu verstehen, sondern in einem geistlichen. Die Laster hinderten den Menschen nämlich an der Begegnung mit Gott bzw. dem Erreichen der Vollkommenheit. Evagrios zählte zu den Lastern die Völlerei, die Unzucht, die Habsucht, die Traurigkeit, den Zorn, die innere Unruhe (Akedia), die Ruhmsucht und den Stolz. Er entwickelte eine ausgefeilte Methodik, wie man derartige Gedanken und Begierden bekämpfen konnte. Eben durch solch einen Weg diente die Einsamkeit dann dem geistlichen Fortschritt. In diesem Sinn vermochte derselbe Hieronymus, der die schwierigen Aspekte der Einsamkeit durchaus zu benennen vermochte, die Wüste auch als einen Ort der spirituellen Entwicklung zu preisen:
»O Wüste, die du dich zeigst in der Frühlingspracht der Blumen Christi! O heilige Einsamkeit, in der die Steine wachsen, aus denen nach den Worten der Apokalypse die Stadt des großen Königs erbaut wird! O verlassene Stätte, in der man sich des vertrauteren Umgangs mit Gott erfreut! Was willst Du, mein Bruder, in der Welt, der Du erhaben über der Welt stehst? Wie lange sollen der Häuser Schatten auf Dich drücken? Wie lange soll Dich der rauchgeschwängerte Kerker dieser Städte festhalten? Glaube mir, ich weiß nicht, was ich allein an Tageshelle hier mehr genieße. Hier kann man sich der Bürde des Körpers entledigen und sich zum Glanz des Äthers emporschwingen. […]« 3
Die Äußerungen des Hieronymus entsprechen sicher weniger modernen Idealen als denen der spätantiken Welt. In einer Umgebung, in der stoisch geprägte Philosophen nach Unberührbarkeit (ataraxia; vgl. a. Athan. V. A. 51) oder gar Leidenschaftslosigkeit (apatheia) der Seele strebten, in einem Umfeld, in dem neuplatonische Philosophen sich nach der Vereinigung mit dem Ureinen sehnten, erschien die von Hieronymus besungene »heilige Einsamkeit « durchaus ein erstrebenswerter Weg zu einem »vertrauteren Umgang mit Gott«. Im Blick auf die Unberührbarkeit hielten schließlich bedeutende Autoren der Wüste wie Johannes vom Sinai, genannt Klimakos, über die Hesychia, die Ruhe, dementsprechend fest:
»Der Anfang der Hesychia ist, Geräusche abzuwehren, die bis auf den Grund Unruhe verursachen. Das Ende dieser dagegen ist, sich nicht vor Beunruhigungen zu fürchten, sondern ihnen gegenüber unempfindlich zu werden.« 4
Der Weg der Hesychia, der Ruhe, ist also letztlich nichts anderes als ein Weg der Selbsterkenntnis. So formulierte trefflich der Altvater Palladios: »[…] Da wir nun wissen, Kinder, welchen Werkes diese Zeit bedarf, lasst uns uns selbst erkennen durch das Leben in der Stille. Diese Zeit erfordert nämlich, dass wir den guten Sinneswandel vollziehen, damit wir in Wahrheit zu Tempeln Gottes werden (vgl. 1 Kor 3,16 f.) […].«5
Einsamkeit und Egozentrismus?
Es legt sich nahe, in den Eremiten der Spätantike also doch exaltierte Egozentriker zu sehen, die allein um ihr eigenes Seelenheil bemüht waren und sich dafür von der Umwelt absonderten. Die Zurückgezogenheit und Ruhe der Wüstenv.ter und -mütter führt aber keineswegs in eine absolute Abwendung von dem, was man gewöhnlicherweise als »die Welt« bezeichnet. Michael Schneider hat die Haltung der Ruhe und Abgeschiedenheit einmal treffend folgendermaßen charakterisiert:
»Schweigen dient den Mönchen in der Wüste nicht bloß zur Vertiefung ihres geistlichen Lebens oder um besser ›zur Ruhe kommen‹ zu können, vielmehr ist das Schweigen ein Lebensprozeß und eine Grundhaltung vor Gott; als solche steht die Übung des Schweigens im Zusammenhang mit vielen anderen Dingen des Mönchslebens, nämlich der Arbeit, dem Gottesdienst, dem Fasten und Almosengeben etc.« 6
Die Anachorese, der Weg in die Wüste, ist also eher der Weg zu einer neuen Haltung in der Welt als die vollkommene soziale Isolation. Peter Sloterdijk dürfte daher in seinem Buch »Weltfremdheit « keineswegs richtig liegen, wenn er feststellt: »Die Wüste« ist seit dem frühen Mönchtum »nur ein anderes Wort für den Weltschatten, in dem sich Menschen treffen, sofern sie die Welt weder interpretieren noch verändern, sondern weglassen wollen.«7 Neuere Arbeiten im Bereich der Mönchsgeschichte haben es immer wieder betont: Mönche und Nonnen stehen nach wie vor in sozialen Netzwerken, sie wirken zurück in »die Welt«. Durch ihre neue Haltung gehen sie aber anders mit dieser um. Sie halten ihr sozusagen einen Spiegel vor, indem sie viele traditionelle Werte und Verhaltensweisen wie Konsum und Erfolg, materialistisches Leistungsdenken und bürgerliche Strukturen auf den Prüfstand stellen.
Ein Zeugnis dafür, dass die altkirchliche Anachorese breite Spuren auch über die Wüste hinaus hinterließ, stellen die zahlreichen Berichte darüber dar. Kaum eine Textgattung war in der Spätantike so beliebt wie diejenige der Sprüche der Wüstenv.ter. Die Handschriftenüberlieferung zeugt bis heute davon, dass die Erzählungen über die frühen Eremiten und Anachoreten immer und immer wieder kopiert worden sind. Adressaten solcher Textsammlungen waren dabei keineswegs nur Klostergemeinschaften. Das Paradiesgärtlein (Leimonarion) des Johannes Moschos wurde jedenfalls nicht nur in Klosterbibliotheken überliefert. Die Historia Lausiaka mit Erzählungen über Asketinnnen und Asketen wurde sogar zur Erbauung der gehobenen Gesellschaft Konstantinopels geschrieben. Und die Leiter (Klimax) des Johannes vom Sinai war ein geistliches Handbuch nicht nur für Mönche, sondern auch für die sogenannten Laien. Die Eremiten lebten also nicht nur für sich selbst, sie hielten vielmehr der Welt auch immer wieder einen Spiegel vor Augen, konfrontierten die Lebensgewohnheiten »der Welt« mit kritischen Anfragen.
Darüber hinaus wird in zahlreichen Darstellungen der altkirchlichen Askese festgehalten, dass sich selbst Eremiten um Gäste, Bedürftige und Kranke kümmerten. Einsiedler-Kolonien und natürlich erst recht die großen Wüstenkl.ster betrieben entsprechende Einrichtungen. Der Rückzug in die Wüste war somit in der Regel meist nicht einfach nur eine egozentrische Abwendung von der übrigen Welt. Die Gefahren des Rückzugs Bereits Johannes Klimakos warnte in einem eindrücklichen Spruch davor, dass der Rückzug in die Ruhe und die Einsamkeit auch gefährlich sein kann. Dies gelte insbesondere für Menschen mit seelischen Erkrankungen:
»Wer an einer psychischen Krankheit leidet und sich an der Hesychia (scil. der inneren Ruhe) versucht, gleicht jemandem, der vom Schiff ins Meer springt und glaubt, auf einem Holzbalken gefahrlos das Land erreichen zu können.« 8
Die Wüstenväter waren sich der Tatsache äußerst bewusst, dass der Rückzug in die Wüste ohne eine gute geistliche Begleitung kaum zu leisten ist. Deswegen spielte das Institut der Geistlichen Vaterschaft für die Wüstenv.ter und -mütter eine zentrale Rolle. Der einzelne Mönch, so Johannes Sinaites in demselben Kapitel seines spirituellen Handbuchs, »braucht große Wachsamkeit und einen unzerstreuten Geist«,9 über den keineswegs jeder verfügt. Das Einzelgängertum erfordere ohnehin »engelhafte Kraft«.10 Daher haben jüngere Mönche und Nonnen meist immer mit einem älteren geistlichen Vater oder einer älteren geistlichen Mutter in einem Kellion zusammengelebt. Darüber hinaus zeugen einige Texte davon, dass gerade in der Zeit des Rückzugs ein deutliches Vorbild oder eine klare Tagesstruktur notwendig sind, wenn man schon nicht über eine Regel verfügt. So wird ein solches strukturiertes Programm in einem Wüstenv.terspruch, einem sogenannten Apophthegma, geboten:
»Einem Bruder, der in der Wüste der Thebais (scil. in Oberägypten) wohnte, kam der Gedanke: ›Was sitzt du hier so unfruchtbar da? Auf, geh in ein Koinobion (scil. ein Kloster mit gemeinsamen Leben), und dort wirst du Frucht bringen. Er stand also auf, kam zum Altvater Paphnutios und teilte ihm seinen Gedanken mit. Der Greis sagte zu ihm: ›Geh fort und setze dich in dein Kellion. Verrichte ein Gebet am Morgen, eines am Abend und eines in der Nacht. Wenn Du Hunger hast, dann iß, wenn du Durst hast, dann trinke, und wenn du Schlafbedürfnis hast, dann schlafe. Bleibe in der Wüste und laß dich nicht auf den Gedanken ein.‹ […].« 11 Und der bekannteste aller Wüstenv.ter wurde nach einem anderen Apophthegma sogar ein Vorbild für die notwendige Tagesstruktur vor Augen gestellt: »Als der Altvater Antonios einmal in verdrießlicher Stimmung und mit düsteren Gedanken in der Wüste saß, sprach er zu Gott: ›Herr, ich will gerettet werden, aber meine Gedanken lassen es nicht zu. Was soll ich in dieser meiner Bedrängnis tun? Wie kann ich das Heil erlangen?‹ Bald darauf erhob er sich, ging ins Freie und sah einen, der ihm glich. Er saß da und arbeitete, stand dann von der Arbeit auf und betete, setzte sich wieder und flocht an einem Seil, erhob sich dann abermals zum Beten; und siehe, es war ein Engel des Herrn, der gesandt war, Antonios Belehrung und Sicherheit zu geben. Und er hörte den Engel sprechen: ›Mach es so und du wirst Heil erlangen.‹ Als er das hörte, wurde er von großer Freude und mit Mut erfüllt und durch solches Tun fand er Rettung.« 12
Diese Erzählung ist die erste der Alphabetischen Sammlung der Sprüche der Wüstenv.ter. Den Redaktoren der Sammlung war wohl deutlich, dass ein einfacher Rückzug in die Einsamkeit meist zum Scheitern verurteilt ist, zumindest leicht in Trübsal enden kann. Dementsprechend stellten sie diese Erzählung an den Anfang aller Weisungen für ein eremitisches Leben. Die Sprüche der Wüstenväter und -mütter können eine Hilfe sein, den Lebensalltag in der Wüste konstruktiv zu gestalten. Ohne solche Vorbilder, ohne Menschen, die einen auf einem solchen Weg begleiten, sollte man sich in den meisten Fällen besser nicht in die Anachorese begeben.
Prof. Dr. Andreas Müller ist Inhaber der Professur für Kirchen- und Religionsgeschichte des 1. Jahrtausends an der Theologischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität Kiel. 11
[1] Philo von Alexandrien, Über den Dekalog 2,13, dt. in: Leopold Cohn (Übers.) u. a. Philo von Alexandria. Die Werke in deutscher Übersetzung 1, Berlin 21962, 373.
[2] Hieronymus, Brief an Eustochium 22,7, dt. Alfons Heilmann (Hg.), Texte der Kirchenväter I, München 1963, 529 f.
[3] Hieronymus, Brief 14 an Heliodor, dt. in Ludwig Schade (Übers.), Des Heiligen Kirchenvaters Eusebius Hieronymus Ausgewählte Briefe I, BKV 2. Reihe 16, München 1936, 289 f.
[4] Johannes Sinaites, Klimax 27,3, dt. in: Georgios Makedos (Übers.), Heiliger Johannes vom Sinai Klimax oder Die Himmelsleiter, Athen 2000, 309.
[5] Johannes Moschos, Leimonarion 69, dt. in: Johannes Moschos, Leimonarion oder Die Wiese, übers. vom Heiligen Kloster Johannes’ des Vorläufers, Chania 2008, 75.
[6] Michael Schneider, Aus den Quellen der Wüste. Die Bedeutung der frühen Mönchsväter für eine Spiritualität heute, Schriftenreihe des Zentrums KOINONIA-ORIENS im Erzbistum Köln 24, Köln 21989, 77.
[7] Peter Sloterdijk, Weltfremdheit, edition Suhrkamp 1781, Frankfurt a. M. 1993.
[8] Johannes Sinaites, Klimax 27,11, dt. in: Georgios Makedos (Übers.), Heiliger Johannes vom Sinai Klimax oder Die Himmelsleiter, Athen 2000, 310.
[9] Ebd.
[10] Ebd.
[11] Gerontikon Paphnutios 5, dt. in: Weisung der Väter. Apophthegmata Patrum, auch Gerontikon genannt, übers. Bonifaz Miller, Trier 31986, 258 f., Nr. 790.
[12] Gerontikon Antonios 1, dt. in: Weisung der Väter. Apophthegmata Patrum, auch Gerontikon genannt, übers. Bonifaz Miller, Trier 31986, 15.
Wie ich die Teilung Deutschlands und die Trennung der Kirchen in Ost und West erlebt habe
von Hartmut Löwe
Kindheit, Jugend und die längste Zeit des Erwachsenenlebens kannte ich nur ein geteiltes Deutschland. Der eine Teil, in dem ich aufgewachsen bin, war mit dem Ende des zweiten Weltkriegs im Jahre 1945 die sowjetische Besatzungszone geworden, aus der im Oktober 1949 der DDR-Staat entstand, der andere, von Amerikanern, Engländern und Franzosen besetzt, wurde, noch vor der Gründung der DDR, die Bundesrepublik Deutschland. Diese Teilung wurde in meinem Elternhaus nur zögernd akzeptiert und als vorübergehend eingeschätzt. Deutschland war im Bewusstsein der Generation meiner Eltern eine Einheit. Die Teilung konnte nach dem Urteil meines Vaters unmöglich von Dauer sein.
In der von den Russen besetzten Ostzone lebten bald wieder die Länder der Vorkriegszeit auf. Wir wohnten in Thüringen, die anderen Ostdeutschen in Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg. Der Osten der viergeteilten Stadt Berlin war eine eigene Einheit. Er wurde von der Regierung der DDR als Hauptstadt beansprucht. Ostpreußen, Pommern und Schlesien waren verloren. Millionen von Flüchtlingen und Vertriebenen suchten ein neues Zuhause fern ihrer Heimat und fanden schließlich mit der Zeit in Rest-Deutschland ihr Auskommen. Viele freilich blieben nicht im Osten und wanderten über die Grenze weiter in den Westen, wo die Lebensbedingungen nach der Währungsreform ungleich vorteilhafter waren. Dabei gab die Mehrheit die von Polen, Tschechen und Russen besetzten Gebiete nicht verloren. Eine große Zahl redete lange Zeit noch von einer Rückkehr in die verlassenen Ostgebiete, hatte sich aber bald schon in Rest- Deutschland eingerichtet.
Kindheit, Jugend und die längste Zeit des Erwachsenenlebens kannte ich nur ein geteiltes Deutschland. Der eine Teil, in dem ich aufgewachsen bin, war mit dem Ende des zweiten Weltkriegs im Jahre 1945 die sowjetische Besatzungszone geworden, aus der im Oktober 1949 der DDR-Staat entstand, der andere, von Amerikanern, Engländern und Franzosen besetzt, wurde, noch vor der Gründung der DDR, die Bundesrepublik Deutschland. Diese Teilung wurde in meinem Elternhaus nur zögernd akzeptiert und als vorübergehend eingeschätzt. Deutschland war im Bewusstsein der Generation meiner Eltern eine Einheit. Die Teilung konnte nach dem Urteil meines Vaters unmöglich von Dauer sein. In der von den Russen besetzten Ostzone lebten bald wieder die Länder der Vorkriegszeit auf. Wir wohnten in Thüringen, die anderen Ostdeutschen in Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg. Der Osten der viergeteilten Stadt Berlin war eine eigene Einheit. Er wurde von der Regierung der DDR als Hauptstadt beansprucht. Ostpreußen, Pommern und Schlesien waren verloren. Millionen von Flüchtlingen und Vertriebenen suchten ein neues Zuhause fern ihrer Heimat und fanden schließlich mit der Zeit in Rest-Deutschland ihr Auskommen. Viele freilich blieben nicht im Osten und wanderten über die Grenze weiter in den Westen, wo die Lebensbedingungen nach der Währungsreform ungleich vorteilhafter waren. Dabei gab die Mehrheit die von Polen, Tschechen und Russen besetzten Gebiete nicht verloren. Eine große Zahl redete lange Zeit noch von einer Rückkehr in die verlassenen Ostgebiete, hatte sich aber bald schon in Rest- Deutschland eingerichtet.
1945 bis 1953
Das größere Deutschland war auch deshalb für mich selbstverständlich, weil der Kirchenkreis Schmalkalden, zu dem meine Heimatstadt Steinbach-Hallenberg gehörte, ein Dekanat der früher Hessen-Kassel, seit 1934 Kurhessen Waldeck genannten Landeskirche war. Die Pfarrer wechselten zwischen Ost und West, gelegentlich auch von West nach Ost. Der Bischof, die Pröpste, die Oberkirchenräte aus Kassel kamen regelmäßig zu Besuchen und Besprechungen. In der Synode waren Plätze für Vertreter des Dekanats Schmalkalden reserviert. Einige kurhessische Vikare absolvierten ihre praktische Ausbildung im Kirchenkreis Schmalkalden und blieben dort nach ihrer Ordination. Aber die vor 1945 aus Hessen gekommenen Pfarrer kehrten bald in ihre Heimat zurück. An ihrer Stelle amtierten inzwischen Flüchtlingspfarrer aus Schlesien und Ostpreußen, die weniger intensiv mit den hessischen Gepflogenheiten vertraut waren, sich aber bald eingewöhnten. Auch die Lehrer, die früher zum größten Teil aus dem Regierungsbezirk Kassel gekommen waren, wurden durch Vertriebene und Thüringer ersetzt.
Das kirchliche Leben war in den ersten Nachkriegsjahren intensiv, kräftiger als in der vorausgegangenen Zeit des Nationalsozialismus. Wer damals aus Überzeugung oder, das war häufiger, Opportunismus seine Mitgliedschaft in der Kirche aufgekündigt hatte, kehrte zurück, jedenfalls in den ländlichen Gebieten. Die russische Besatzungsmacht und ihre deutschen Statthalter behinderten anfangs das kirchliche Leben nicht, sie waren im Gegenteil wohlwollend fördernd. Die kirchliche Jugend sammelte sich in großer Zahl in der Jungen Gemeinde und an den Hochschulen, in den Studentengemeinden. Die Kirchen hatten ihren Platz in der Gesellschaft zurückgewonnen, es sah für sie hoffnungsvoll aus. Ein neuer Frühling schien auszubrechen. Im Jahre 1950 sind in der Steinbach-Hallenberger Gemeinde alle 1935 und 1936 Geborenen und evangelisch Getauften konfirmiert worden. Es herrschten volkskirchliche Verhältnisse.
Als Rektorin der Volksschule amtierte eine unbelastete Lehrerin, die sich auch im kirchlichen Leben vor allem durch Kirchenkonzerte – sie hatte eine schöne Stimme im Mezzosopran – hervortat.
Das alles wurde anders, als in den 50er Jahren die Länder aufgelöst wurden und an ihre Stelle Bezirke als Verwaltungseinheiten traten. Ein Zentralstaat löste die föderalen Strukturen ab. Die Verhältnisse änderten sich schleichend, nicht über Nacht, unterschiedlich auch in den verschiedenen Landstrichen, den Städten und Dörfern. Hatten zunächst die Kirchen auf freiwilliger Basis in den Schulen Religionsunterricht erteilt, stellte man ihnen jetzt immer seltener Klassenräume zur Verfügung. Die staatlichen Lehrer gaben ohnehin keinen Religionsunterricht mehr. Die Kirchen bildeten eigene Religionslehrer aus, Katecheten genannt. Bei uns in Steinbach-Hallenberg unterrichtete im Gemeindehaus die Diakonisse Schwester Martha an den Nachmittagen die einzelnen Jahrgangsstufen. Die große Mehrheit nahm teil, zumal sie eine vorzügliche Pädagogin war.
In den Schulen wurde die marxistisch-leninistische Weltanschauung zur herrschenden Doktrin, nicht nur im Fach Gesellschaftskunde. Auch in den Fächern Deutsch und Geschichte sollten die sozialen Verhältnisse, der Kampf der Klassen, der dialektische Materialismus besondere Aufmerksamkeit finden. Aber zahlreiche Lehrer von bürgerlicher Herkunft waren frei von marxistischer Ideologie. Sie waren geprägt von den Professoren, bei denen sie noch vor 1933 studiert hatten. Unsere Deutschlehrerin Ilse Fuchs, Tochter eines nach dem 1. Weltkrieg aus dem Elsass gekommenen Pfarrers, hatte zwischen den Kriegen in Bonn studiert und unterrichtete ihr Fach ohne Zugeständnisse an die neuen politischen Verhältnisse.
Wurde in den ersten Nachkriegsjahren die Kirchensteuer noch von den staatlichen Behörden eingezogen, hörte diese überkommene Zusammenarbeit zwischen Staat und Kirche 1954 auf, die »hinkende Trennung« (E. Stutz) zwischen Staat und Kirche sollte endlich nicht nur, wie von der Weimarer Verfassung behauptet, sondern tatsächlich radikal vollzogen werden. Die materiellen Lebensbedingungen der Kirchen wurden schwieriger. Jetzt zogen eigene Kirchenämter den nach wie vor Steuer genannten Mitgliedsbeitrag ein, allerdings ohne Kenntnis der Einkommensverhältnisse der Mitglieder, nur Schätzungen waren möglich. Die westlichen Kirchen sprangen ein und trugen durch gro.zügige Transferleistungen zum Ausgleich der kirchlichen Haushalte bei. Das änderte sich nicht bis zum Jahr der Revolution 1989. So war das finanzielle Überleben der Kirchen in der DDR leidlich gesichert. Die Löhne der kirchlichen Mitarbeiter waren gering, hatten längst nicht das westliche Niveau und waren auch für DDR-Verhältnisse bescheiden.
1953 bis 1961
Die blühende kirchliche Jugendarbeit und die ungewöhnlich aktiven Studentengemeinden an den Universitäten waren dem Staat ein Dorn im Auge geworden. Die Freie Deutsche Jugend (FDJ) als einzige Jugendorganisation des Staates sollte nicht im Schatten der formal nicht einmal organisierten kirchlichen Jugendarbeit bleiben. Der Staat drang auf Konformität und eine einheitlich sozialistische Erziehung. Es begann ein Kampf um den Einfluss auf die Jugend. An der Spitze der Steinbacher Volksschule musste Elisabeth Jachan das Rektorat räumen. An ihre Stelle trat ein linientreuer Parteigenosse. Die Durchführung kirchlicher Zusammenkünfte, Freizeiten genannt, wurde erschwert, teilweise verboten. Fanden sie ohne ausdrückliche staatliche Genehmigung doch statt, wurden sie immer wieder aufgelöst, obwohl in kirchliche Häuser eingeladen worden war. Nach Stalins Tod im März 1953 begann verstärkt das Ringen um die Jugend. Die Mitgliedschaft in der staatlichen Freien Deutschen Jugend (FDJ) wurde quasi verpflichtend. Auch von der Organisation für Kinder, den Jungen Pionieren, konnte man sich nur schwer fernhalten. Wenige hatten den Mut, diesen Organisationen nicht beizutreten und wahrten ihre Unabhängigkeit. Im Frühjahr 1953 begann ein Kirchenkampf. An vielen höheren Schulen wurden Schüler von der Schule verwiesen. An der Schmalkalder Oberschule traf es mich. Über die DDR verteilt waren es Tausende. Der Vorwurf lautete: Unterstützung des westdeutschen Revanchismus, verderblicher politischer Einfluss auf die Mitschüler. Das geschah völlig unvorbereitet aus heiterem Himmel. Es war eine der zahlreichen Schulvollversammlungen angesetzt, in der wir in der Regel politische Resolutionen zu unterstützen hatten. Aber es geschah mehr. Schon dass ein Berliner Funktionär der SED anwesend war, eine flammende Rede hielt, in der er meinen Namen nannte und mich als Gegner der DDR bezeichnete, war so noch nicht da gewesen. Die Mitschüler sollten meinen Ausschluss von der Schule beschließen. Als ich zur Rechtfertigung aufgerufen wurde und aus dem Stegreif eine Verteidigungsrede halten musste, es war wohl die beste Rede, die ich jemals gehalten habe, raste die Aula und stellte sich fast geschlossen hinter mich. Der Antrag auf Ausschluss fand keine Mehrheit. So etwas war noch nicht da gewesen. Aber es war nur ein geringer Aufschub. Wenige Tage später beschloss das Lehrerkollegium, was meine Mitschüler verweigert hatten. Die kirchliche Jugendarbeit verlor an Attraktivität, die Studentengemeinden mussten um ihre Existenz kämpfen und bü.ten ihren Einfluss ein. Der Staat lehnte den Einzug der Kirchensteuer ab. Im Juni 1953 kam es zu einem Aufstand von Arbeitern in zahlreichen Städten, zuerst in Berlin. Zunächst ging es nur um die Verweigerung neuer Arbeitsnormen, die den Arbeitern einen größeren Einsatz bei gleichem Lohn abforderten. Bald spielte der Anlass keine Rolle mehr. Die Werktätigen widersetzten sich dem repressiven politischen System und verlangten Demokratie sowie die Abschaffung der Zonengrenzen zwischen Ost und West. In höchster Not kamen der DDRRegierung die im Land stationierten russischen Panzer zu Hilfe. Das angeschlagene politische System wurde wieder stabilisiert. Jetzt hörten für eine Weile die Unterdrückung kirchlicher Arbeit und die politische Gängelung der Bevölkerung auf. Auf Weisung Moskaus versuchten die DDR-Machthaber einen konzilianteren Weg. Schülerinnen und Schüler durften an ihre Schulen zurückkehren. Ich jedoch, inzwischen in einem kirchlichen Internat in der hessischen Schwalm untergekommen, blieb auf Anraten meines Vaters dort. Man wisse ja nicht, ließ er mich telefonisch wissen, wann sich der Staat von seinem Schwächeanfall erholt habe und zu den alten Repressionen zurückkehre. So seine kluge Einschätzung der politischen Verhältnisse.
Von diesem Zeitpunkt, also ab Mitte 1953, erlebte ich das geteilte Deutschland auf der westlichen Seite, der Bundesrepublik. Zu meinem Zuhause blieb allerdings noch lange Zeit die Verbindung eng. Der kurzfristigen Liberalisierung wegen konnte ich schon Weihnachten 1953 wieder in meiner Familie verbringen. Auch die Schulferien verbrachte ich in den letzten beiden Schuljahren in Thüringen. Erst während meines Studiums wurden die Grenzen auch für mich dicht. Mutter und kleine Schwester, der Vater war 1955 gestorben, durfte ich jetzt nicht mehr besuchen.
Überraschenderweise erhielt meine westliche Klasse vor dem Abitur (1956) die Erlaubnis zu einer Studienfahrt nach Eisenach, Schmalkalden und Weimar, damals eine ganz ungewöhnliche Möglichkeit. Aber solche Erlaubnisse gab es bald schon wieder nicht mehr. Jetzt, ab 1955, setzte auch der staatliche Kampf gegen die Konfirmation und für eine sozialistische Jugendweihe ein. Die Kirche nahm den Fehdehandschuh auf und lehnte den Vorschlag ab, an beiden Übergangsriten teilzunehmen, der staatlichen Jugendweihe und der kirchlichen Konfirmation. Lehrerinnen und Lehrer wurden zu Hausbesuchen bei den Eltern der infrage kommenden Jugendlichen verpflichtet. Sie warben für die Teilnahme an der Jugendweihe, auch wenn sie von dem staatlichen Vorhaben nur mäßig oder gar nicht überzeugt waren. Meine Mutter blieb standhaft und lehnte für ihre jüngste Tochter die Verbindung von Jugendweihe und Konfirmation ab. In unserer Familie wurde ausschließlich die Konfirmation gefeiert. Die evangelische Kirche allerdings hatte ihre Kräfte und ihren Rückhalt in der Bevölkerung übersch.tzt. Die DDR war nicht Polen, die kirchlichen Bindungen waren sehr viel schwächer, vor allem in den Städten. Die Kirche hielt zwar an der Unvereinbarkeit von Konfirmation und Jugendweihe fest. Aber bald schon musste sie Kompromisse eingehen und erlaubte den Jugendlichen, die an der Jugendweihe teilgenommen hatten, ein Jahr später die Konfirmation nachzuholen. Das volkskirchliche Gefüge war ins Wanken gekommen, der Einfluss der Kirche auf die Gesellschaft marginal geworden.
Dabei war die kirchenpolitische Ausrichtung der einzelnen Landeskirchen unterschiedlich. In Thüringen gab es eine besondere Nähe zwischen Staat und Kirche; das änderte sich erst, als 1978 Werner Leich an die Spitze der Landeskirche als Landesbischof trat. Viele Pfarrer jedoch kündigten auch dann nicht den Thüringer Weg der Kooperation auf, einige arbeiteten sogar eng mit dem Staatssicherheitsdienst als informelle Mitarbeiter zusammen. Anders sah es in Berlin-Brandenburg aus. Bischof Otto Dibelius, zugleich Vorsitzender des Rates der EKD, publizierte sogar in einer Streitschrift die Auffassung, in einem Unrechtsstaat wie der DDR sei man nicht einmal verpflichtet, die Straßenverkehrsordnung einzuhalten. Er bü.te das mit dem Verbot, seine Gemeinden in Brandenburg zu besuchen, so dass dort eine eigene Kirchenleitung installiert werden musste. So dezidiert wie Dibelius äußerten sich die Bischöfe in Sachsen, Provinz Sachsen, Mecklenburg, Rest-Schlesien (Görlitz) und Pommern nicht. Den kommunistischen kirchenfeindlichen Staat lehnten aber auch sie entschieden ab. Zwischen Staat und Kirche herrschte ein eisiges Klima, Schweigen.
Die Theologischen Fakultäten an den Universitäten ließ der Staat bestehen. Immer wieder einmal wurde die Einrichtung einer rein kirchlichen Ausbildung der Pfarrer debattiert. Aber an den staatlichen Universitäten hoffte der Staat, mehr Einfluss auf die Professoren und Theologiestudenten zu haben. Er konnte die Zulassung missliebiger oder die herrschenden Verhältnisse ablehnender Bewerber kontrollieren oder diese gar vom Studium ausschließen. So kam es für die Ausbildung der Pfarrer zusätzlich zu drei Kirchlichen Hochschulen in Ost-Berlin, Leipzig und Naumburg. An ihnen gab es auch die Möglichkeit für Jugendliche, die zu einer staatlichen Oberschule nicht zugelassen worden waren, an Seminaren (humanistischen Schulen) einen Abschluss zu erwerben, der allerdings kein Studium an einer Universität zuließ, sondern auf die Kirchlichen Hochschulen beschränkt blieb. Die in der DDR faktisch abgeschaffte humanistische Ausbildung lebte an den kirchlichen Ausbildungsstätten fort, an denen man Latein und Griechisch lernte und die Fächer Deutsch und Geschichte ohne die Ideologie des dialektischen Materialismus unterrichtet wurden. Dieser Weg stand jedoch nur einer kleinen Minderheit offen, vor allem Kindern aus Pfarrhäusern, denen man verwehrt hatte, eine staatliche Oberschule zu besuchen. Bei der Revolution 1989 spielten die kirchlichen Seminare und Hochschulen eine wichtige Rolle im Unterschied zu den angepassten staatlichen Universitäten, die – anders als in Polen oder der Tschechoslowakei – als Kräfte der Rebellion und Veränderung völlig ausfielen.
1961 bis 1979
Der Bau der Mauer am 13. August 1961 bildete einen entscheidenden Einschnitt in politischer und kirchlicher Hinsicht. Die ostdeutsche Bevölkerung wurde eingesperrt, Familien endgültig getrennt. Die Evangelische Kirche in Deutschland, die bis dahin auch in politischer Hinsicht eine gesamtdeutsche Klammer gebildet hatte, konnte nicht mehr in gemeinsamen Gremien tagen. Der Staat verlangte, dass Staatsgrenzen auch von den Kirchen zu respektieren seien. Organisationen über die Grenzen hinaus waren verboten. Die Synode der EKD kam zunächst an getrennten Orten zusammen, mit einer gemeinsamen Tagesordnung und räumlich getrennten Abstimmungen und Wahlen. Aber alle Schwüre, die Einheit der Evangelischen Kirche in Deutschland zu bewahren, verloren allmählich an Kraft. Die Realitäten erwiesen sich als stärker als immer wieder beschworene Gefühle der Zusammengehörigkeit. Die gegensätzlichen politischen Ordnungen in Ost und West verlangten die Verhandlung unterschiedlicher Themen in allem, was über streng theologische Sachverhalte wie Gottesdienstordnungen, das gemeinsame Gesangbuch und die gemeinsame Luther-Bibel hinausging. So wuchs der innere Druck auf die DDR-Kirchen, eine eigene Dachorganisation zu schaffen. Im Jahr 1969 war es schließlich so weit. Allerdings hielten die östlichen Landeskirchen in ihrer Verfassung an der besonderen Gemeinschaft zwischen DDR-Kirchenbund und EKD trotz staatlichen Einspruchs fest. Allein in Thüringen plädierte man nicht nur für eine vollständige organisatorische, sondern auch für eine geistliche Trennung. Der Rat der EKD reagierte klug auf die veränderte Situation. Er nahm die Beschlüsse der ostdeutschen kirchlichen Organe lediglich zur Kenntnis, entließ jedoch nicht förmlich die DDR-Landeskirchen aus der 1948 beschlossenen Gemeinschaft. Das war nach 1989 die entscheidende Brücke, die alte Einheit ohne langwierige Verhandlungen wiederaufleben zu lassen. Eine neue Institution mit unabsehbar langen Verhandlungen konnte vermieden werden. Die alte Grundordnung (Verfassung) galt wieder hier und dort.
Der Kirchenkreis Schmalkalden hatte sich 1971 aus der Verbindung mit der kurhessischen Kirche gelöst und Thüringen angeschlossen, allerdings mit einer Reihe von Sonderrechten: keine Änderung des unierten Bekenntnisstandes, eigene Finanzhoheit, Ordination der Pfarrer durch den Schmalkalder Dekan, Visitationen der Gemeinden nur mit Zustimmung der Organe des Kirchenkreises. Wie sich nach 1989 zeigte, hatten die vertragschließenden Kirchen von Kurhessen-Waldeck und Thüringen eine geheime Sondervereinbarung hinterlegt, nach der bei einer etwaigen Änderung der politischen Verhältnisse, also einer damals in weite Ferne gerückten Verbindung von DDR und BRD, beide Seiten frei sein sollten, neu zu entscheiden und zu den alten Zugehörigkeiten zurückzukehren. Schon 1990 wurde für Schmalkalden das Thüringer Zwischenspiel beendet. Ich erinnere mich, dass im Januar 1990 bei einem Treffen des Rates der EKD mit dem Kirchenbund der DDR der Thüringer Landesbischof Leich dem kurhessischen Bischof Jung seine Zustimmung zur Wiederherstellung der alten Verhältnisse signalisierte.
In den 70er Jahren wurden wieder Besuche von durch die Grenze getrennten Familien im sog. Kleinen Grenzverkehr möglich. Wir nutzten diese Erlaubnis sofort und reichlich, auch wenn die Notwendigkeit, Einreise und Ausreise am gleichen Tag zu absolvieren, keine geringe Belastung war. Dazu kamen die unliebsamen Kontrollen bei Ein- und Ausreise. Wir pflegten Arzneimittel für meine Mutter mitzunehmen, die in der DDR nicht zu erhalten waren. Weil das streng verboten war, schärften wir unseren Kindern ein, den kontrollierenden Volkspolizisten davon nichts zu sagen. Johannes, damals noch kein Schulkind, erklärte zu unserem Entsetzen, so dass es die Zöllnerin hören musste: »Wir dürfen nicht sagen, dass wir für die Oma Arzneien dabeihaben.« Meine Frau und ich erstarrten. Aber die Zöllnerin war selten gro.zügig und tat so, als habe sie nichts gehört. So gab es beim Passieren der Grenze immer wieder Konflikte, eine ungewöhnliche psychische Anspannung.
Eine andere Episode. Meine Mutter war gestorben, auf das Erbe (Haus, Grundstücke) hatten meine Berliner Schwester und ich verzichtet, um unsere Anteile nicht dem Staat in den Rachen zu werfen und der in der DDR gebliebenen Schwester das Elternhaus zu sichern. Als einziges Andenken hatte mir meine Mutter sechs bunte böhmische Kristallgläser (Römer) vermacht. Um sie nach dem Westen zu transferieren, musste meine Schwester eine nicht geringe Gebühr in BRD-Währung entrichten. Aber trotz des schriftlichen Nachweises lehnte am Grenzübergang der Zoll die Ausfuhr ab mit der Begründung, es handele sich um Kunstgegenstände, die nicht ausgeführt werden durften. Ich war am Ende meiner Fassung und begann vor Empörung fast zu weinen. Schließlich hatte ein vorgesetzter Grenzpolizist Mitleid mit mir und sagte: »Nehmen Sie die Gläser ausnahmsweise mit.« Ich war am Rande meiner Möglichkeiten. Die DDR-Reisen strapazierten wegen ähnlicher Vorkommnisse die Nerven, sie waren für alle eine Anstrengung.
Im März 1978 kam es zu einem Treffen des Staatsratsvorsitzenden der DDR, Erich Honecker, mit der Leitung des Bundes der DDR-Kirchen. Damit hörte die Sprachlosigkeit zwischen Staat und Kirche auf, eine gewisse Normalisierung der weiter schwierigen wechselseitigen Beziehungen trat ein. Der Staat setzte auf das allmähliche Absterben der Religion, wollte aber die Kirchenmitglieder ihrem Land nicht weiter entfremden. Örtlich unterschiedlich traten einige Erleichterungen ein. Der Kirche verbundene Jugendliche wurden nicht mehr rundweg vom Besuch höherer Schulen ausgeschlossen. In den Neubauvierteln der Städte wurde der Bau von Gemeindehäusern mit Kirchenräumen erlaubt. Aber der finanziell immer knappe Staat ließ sich die Genehmigungen durch Devisen der westlichen Kirchen gut bezahlen. Auch PKW wurden für kirchliche Mitarbeiter mit westlicher Währung bereitgestellt. In die von Diakonie und Caritas unterhaltenen Krankenhäuser konnten medizinische Geräte importiert werden, so dass sie häufig besser ausgestattet waren als staatliche Krankenhäuser, womit sie in der Bevölkerung zusätzlich an Attraktivität gewannen. Aus politischen Gründen inhaftierte Bürger der DDR wurden durch beträchtliche, sich im Laufe der Jahre steigernde Devisen freigekauft und in den Westen entlassen. Da die Regierung der BRD die DDR völkerrechtlich nicht anerkannte, wurden besonders die EKD und ihre Diakonie zu Vermittlern in diesen Geschäften. Manche prangerten, vor allem nach 1989, den Menschenhandel an. Aber es gab keine andere Möglichkeit, Hafterleichterungen und Entlassungen aus den Gefängnissen zu erreichen. Das dafür notwendige Geld freilich kam aus staatlichen Kassen, die Kirche wirkte lediglich als Vermittler.
1980 bis 1989
Inzwischen hatte man sich in Ost und West an die Teilung Deutschlands und der Kirchen gewöhnt. EKD und Kirchenbund arbeiteten in zentralen theologisch-kirchlichen Fragen zusammen. Regelmäßige Konsultationen fanden auf den unterschiedlichsten Ebenen statt. Meine seltenen Verhandlungen mit Manfred Stolpe, dem Leiter des Sekretariats des BEK, empfand ich als schwierig. Ich hatte Respekt vor seinem Verhandlungsgeschick und seiner Fähigkeit, immer noch einen Ausweg zu wissen, wenn alle ratlos kapitulierten. Aber ich fühlte mich seinen diplomatischen Fähigkeiten unterlegen, war ihm einfach nicht gewachsen. Seit 1980 wurde jedes Jahr ein gemeinsames liturgisches Formular für einen der Bewahrung des Friedens gewidmeten Gottesdienst entworfen. Es gelang ein neues gemeinsames Gesangbuch und eine Revision der Luther-Bibel zu erarbeiten. Stellungnahmen zur Erhaltung und Förderung des Friedens fielen in Ost und West dagegen unterschiedlich aus. Die DDR-Kirchen hielten die Verweigerung des Wehrdienstes für das deutlichere Zeichen der Christen, den Frieden zu erhalten. Als ich bei einer der jährlichen Zusammenkünfte des Rates der EKD mit dem Vorstand des DDR-Kirchenbundes zur aktuellen Friedendiskussion vorzutragen hatte und für den NATO-Doppelbeschluss zur Erneuerung des Raketenarsenals auch im Westen als Antwort auf die Aufrüstung im Osten ein vorsichtiges Verständnis signalisierte, trat eisiges Schweigen ein, auf beiden Seiten. Ich hatte den Konsens gestört und war im weiteren Verlauf des Abends isoliert. Kaum einer sprach noch mit mir. Eine Denkschrift der EKD »Der Staat des Grundgesetzes als Angebot und Aufgabe« (1985) löste im BEK mehr als nur Verwunderung aus. Sollen wir uns denn nun auch positiv zum DDR-Staat äußern? lautete der immer wieder erhobene Einwand. Die politische Umwelt prägte in Ost und West den Alltag der Christen.
Außerhalb Deutschlands in internationalen Gremien (Ökumenischer Rat der Kirchen in Genf, Organisationen der europäischen Kirchen) wirkte bei den deutschen Delegierten die gemeinsame Geschichte und das Bewusstsein der Zusammengehörigkeit nach. Bei Abstimmungen votierten sie in der Regel einheitlich. Dabei bevorzugten ausländische Kirchen häufig die DDR-Kirchen; sie galten, weil vom Staat getrennt, als das bessere Deutschland und der EKD moralisch überlegen, weil frei von staatlichen Rücksichtnahmen; sie standen nicht im Verdacht, ihrem Staat hörig zu sein.
Bewegung in die Religionspolitik des DDR-Staats und sein Verhältnis zur evangelischen Kirche brachten die Feiern zum 500. Geburtstag Martin Luthers im Jahre 1983. Der Staat rückte von seiner Bevorzugung des Revolutionärs Thomas Müntzer und der Verteufelung Martin Luthers ab. Er suchte auch durch die Berufung auf Luther seine geschichtliche Legitimation. In einem staatlichen Komitee, das auch Vertreter der Kirche einschloss, organisierte er zahlreiche Gedenkveranstaltungen, renovierte die Gedenkstätten der Reformation, die außer Worms, Coburg und Augsburg sämtlich auf dem Gebiet der DDR lagen. Historiker sahen jetzt die von Luther ausgelöste bürgerliche Revolution als notwendige Voraussetzung der Französischen Revolution und der proletarischen Revolutionen des 20. Jahrhunderts an. Ein Staatsakt demonstrierte das vor aller Augen, vor allem den ökumenischen Gästen aus dem westlichen Ausland. Die Kirchen bekamen freie Hand, zu ihren Gedenkveranstaltungen auch Vertreter der EKD einzuladen. So kamen außer Gästen aus skandinavischen, von Luthers Reformation geprägten Ländern, auch der Erzbischof von Canterbury; sie alle sollten sich von der Religionsfreiheit und den guten Staat-Kirche-Beziehungen in der DDR überzeugen. Mir missfiel dabei, dass wir EKD-Vertreter in einigen Begrü.ungen in vorauseilendem Gehorsam unter die ökumenischen Gäste eingereiht wurden. Wir waren doch, meinte ich, Deutsche, nur durch die Grenze geschieden in Ost und West. Solche vom Staat gerne gehörten Sprachregelungen empfand ich als peinlich. Als die im Anschluss an den Festakt in Eisleben nach Leipzig strebenden Gäste durch von einer Eisschicht überzogenen Straßen behindert wurden, platzierte der Staat Volkspolizisten mit Fackeln entlang der Autobahn. Eine Reihe von regionalen Kirchentagen hatte große Freiheiten. In Wittenberg schmiedete öffentlichkeitswirksam Pfarrer Friedrich Schorlemmer ein Schwert zu einer Pflugschar um. Der damalige Regierende Bürgermeister West-Berlins, Richard von Weizsäcker, beschwor die Zusammengehörigkeit der Deutschen in Ost und West mit der Feststellung, hier wie dort atme man dieselbe Luft. Offizielle Gäste aus der BRD wurden durch die Grenzkontrollen gewinkt, sie brauchten vor den Schlagbäumen nicht einmal anzuhalten. Im Unterschied zu den vielen früheren privaten und dienstlichen Besuchen war das für mich ein bemerkenswertes Erlebnis.
In der Bevölkerung, besonders unter den jungen Leuten, rumorte es allerdings. Abrüstung wurde nicht nur von den Nato- Staaten, sondern auch von denen des Warschauer Pakts gefordert. Kleine Gruppen trafen sich unter den Stichworten Frieden und Ökologie. Weil für sie staatliche Räume nicht zur Verfügung standen, kamen sie unter dem Dach der Kirche zusammen. Die Kirchen billigten nicht einfach die politischen Forderungen der Gruppen, boten ihnen aber Asyl. Rufe nach vom Staat unabhängigen Parteien wurden laut. Mit Berufung auf Rosa Luxemburg forderte man die Freiheit des Denkens ein (»Freiheit ist immer die Freiheit der anderen« zitierten sie die Kommunistin). Diese kirchlichen oder zumindest unter der Protektion der Kirche handelnden Friedensund Umweltgruppen waren, wie sich im Herbst 1989 zeigte, vielfach unterwandert durch Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes. Aber auch diese staatlichen Bespitzelungen konnten den sich Bahn brechenden Drang nach Freiheit nicht mehr eindämmen.
Besonders in Leipzig trafen sich seit vielen Jahren in der Nikolaikirche immer mehr Menschen wöchentlich zu einem Friedensgebet. Bald zogen anschließend Demonstranten durch die Stadt, von Mal zu Mal eine größere Zahl. Es gärte in der Bevölkerung. Der Staat agierte zunehmend hilfloser. Eine militärische Niederschlagung der Proteste und Unruhen wie 1953 war immer weniger aussichtsreich, weil der sowjetische Generalsekretär der KPdSU, Michail Gorbatschow, die Panzer in den Kasernen ließ, ja sogar die Mächtigen in der DDR zu Reformen drängte (»Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben« wurde zum geflügelten Wort). Glückliche Umstände verhinderten ein Blutvergießen wie kurz zuvor in China.
Über das politische Ziel der Proteste bestand innerhalb der verschiedenen Gruppen durchaus keine Einigkeit. Alle aber verlangten freie Wahlen und mehr demokratische Partizipation, einen menschenfreundlichen DDR-Staat, noch nicht seine Auflösung und eine Vereinigung mit der BRD. Das System allerdings war angeschlagen und konnte sich aus eigener Kraft nicht reformieren. Als das Zentralkomitee der SED am 9. November 1989 durch ein Versehen des Pressesprechers Schabowski übereilt die Reisebeschränkungen der DDR-Bevölkerung aufhob und Polizisten wegen des nicht mehr zu beherrschenden Andrangs der Menschen in Berlin die Schlagbäume öffneten, war der Staat nicht mehr länger lebensfähig.
Die politische Einheit der Menschen in Ost und West ließ sich trotz des Widerstandes des französischen Staatspräsidenten Mitterand und der englischen Premierministerin Thatcher nicht mehr aufhalten, vor allem, weil der amerikanische Präsident Bush die Entwicklungen in Deutschland förderte und die Absichten der Bundesregierung unterstützte. Die östlichen Kirchen taten sich jedoch überraschend schwer mit der Rückkehr in die Einheit der EKD und die Auflösung ihres Kirchenbundes. Bereits Anfang Januar 1990 hatte zwar eine routinemäßige Tagung von Vertretern der EKD und des BEK ihre Tagesordnung geändert und in einer rasch beschlossenen Loccumer Erklärung den Willen nach einer neuen Gemeinsamkeit in einer Kirche ausgesprochen. Aber es formierte sich gegen schnelle Entscheidungen Widerstand. Das Nein zum DDR-Staat war bei vielen durchaus nicht mit dem Wunsch verbunden, die Institutionen wiederaufleben zu lassen, die von 1948 bis 1969 gegolten hatten. Vor allem der Religionsunterricht an staatlichen Schulen, der Einzug der Kirchensteuer durch den Staat und, besonders, die Militärseelsorge erwiesen sich als Stolpersteine. Die Frau des provinzsächsischen Bischofs Demke brachte den Unwillen in dem Bild zum Ausdruck, man fühle sich im Osten wie ein von einem reichen Freier umworbenes armes Mädchen, das nicht sofort das erwartete Ja-Wort geben wolle. Aber es war nicht möglich, die politische und kirchliche Einheit Deutschlands durch Zögern und Träumen von einem besseren DDR-Staat zu verhindern. Noch im Januar 1990 gab der Thüringer Landesbischof Leich dem kurhessischen Bischof Jung zu verstehen, er habe keine Einwände gegen eine Rückkehr des Dekanats Schmalkalden in die Landeskirche Kurhessen-Waldeck, aus der es 1971 hatte ausscheiden müssen.
Die Ereignisse lösten bei mir einen Glückstaumel aus und wühlten mich im Innersten auf. In den Weihnachtsferien 1989 fuhr ich alleine mit dem Auto in das unmittelbar an der Grenze gelegene Hohegeiß im Harz. Wie träumend fuhr ich immer wieder auf der Straße von West nach Ost, die früher ein Schlagbaum getrennt hatte, jetzt aber offen war, die Polizisten störten mich nicht. Was ich als Kind noch erlebt hatte und damals für meine Eltern selbstverständlich war: Deutschland war kein geteiltes Land mehr. Es wuchs, wie Willy Brandt es wunderbar formulierte, wieder zusammen, was zusammengehört. Das übrige werde sich finden. Hier waren die politisch Verantwortlichen gefordert. Wir hatten das seltene Glück, dass sie entschlossen, rasch, klug und vorausschauend handelten und das offene Fenster nutzten, solange noch Michail Gorbatschow an der Spitze des sowjetischen Imperiums stand. Der glückliche Zeitpunkt wurde nicht versäumt. Schon am 3. Oktober 1990 lebte ich wieder in einem ungeteilten Deutschland, bald darauf auch in einer nicht mehr getrennten evangelischen Kirche.
Dr. Hartmut Löwe, geb. 1935, ist Pfarrer und war zuletzt Bevollmächtigter des Rates der EKD bei der Bundesrepublik Deutschland und Militärbischof. Er ist Bruder im rheinisch-westfälischen Konvent der Evangelischen Michaelsbruderschaft und lebt in Bonn.