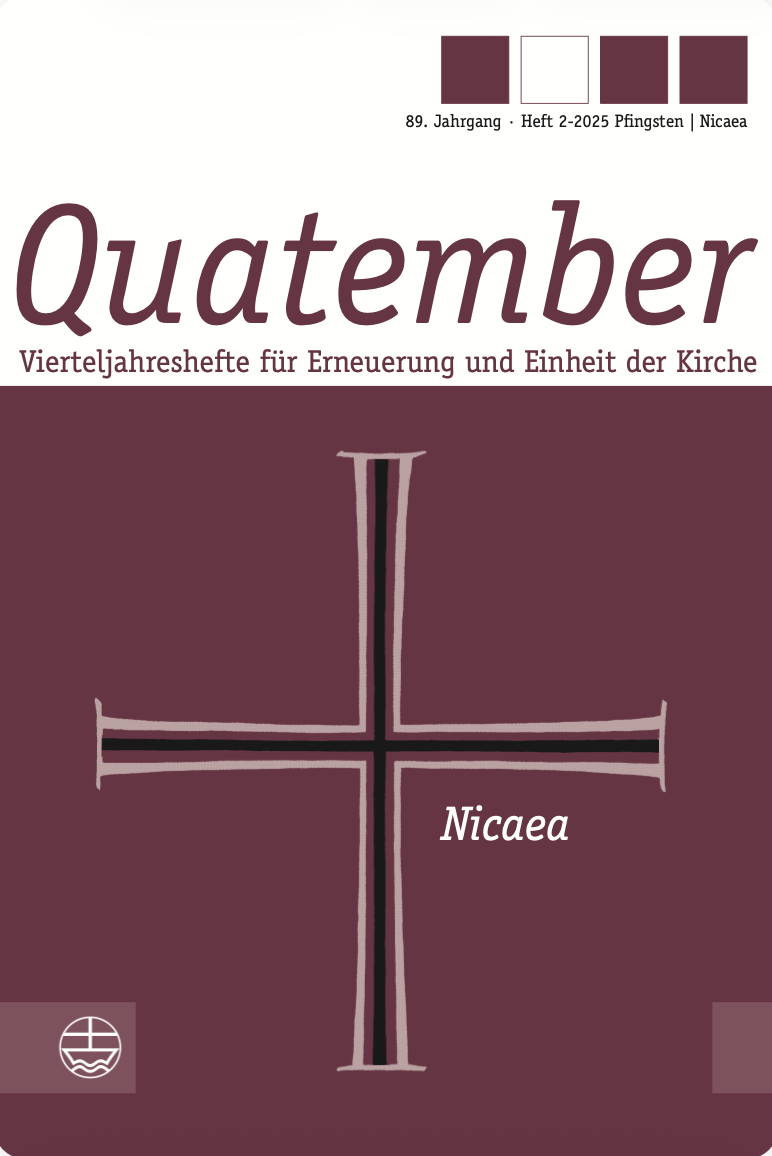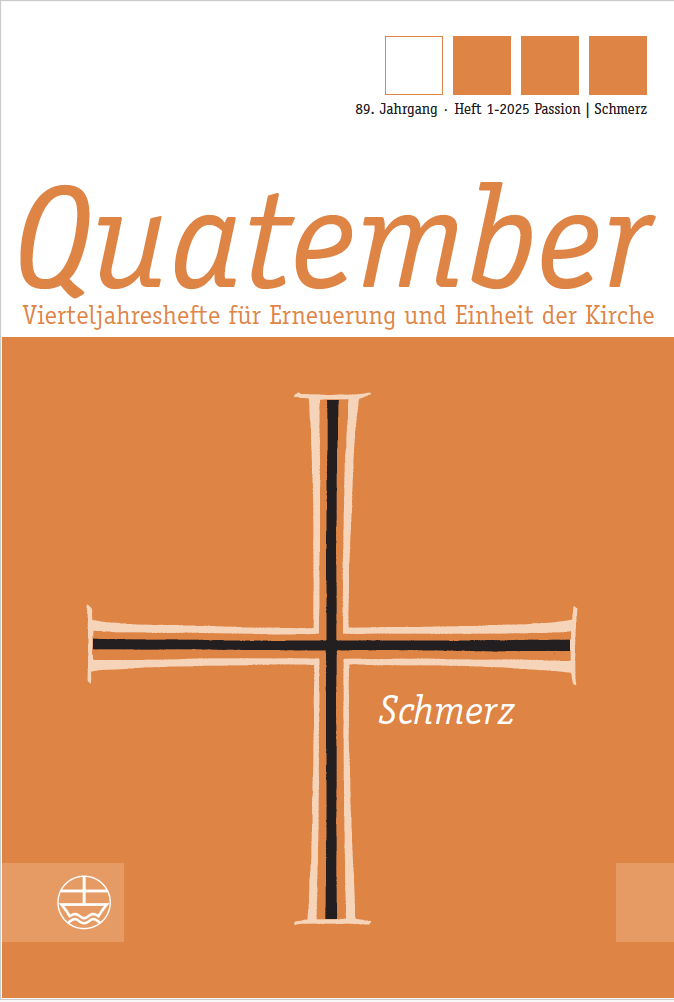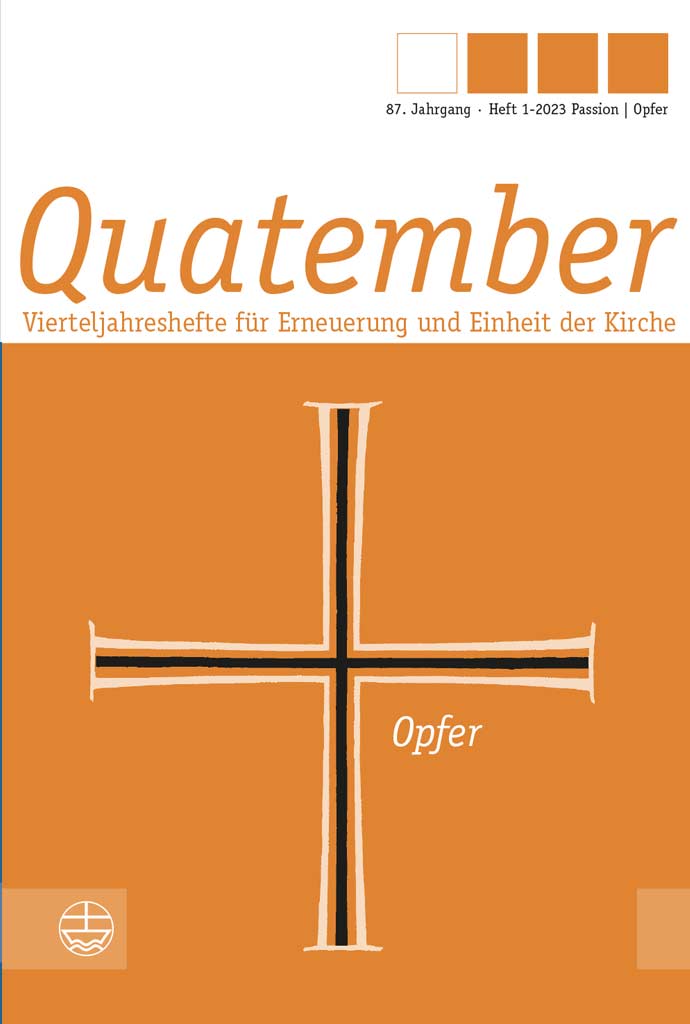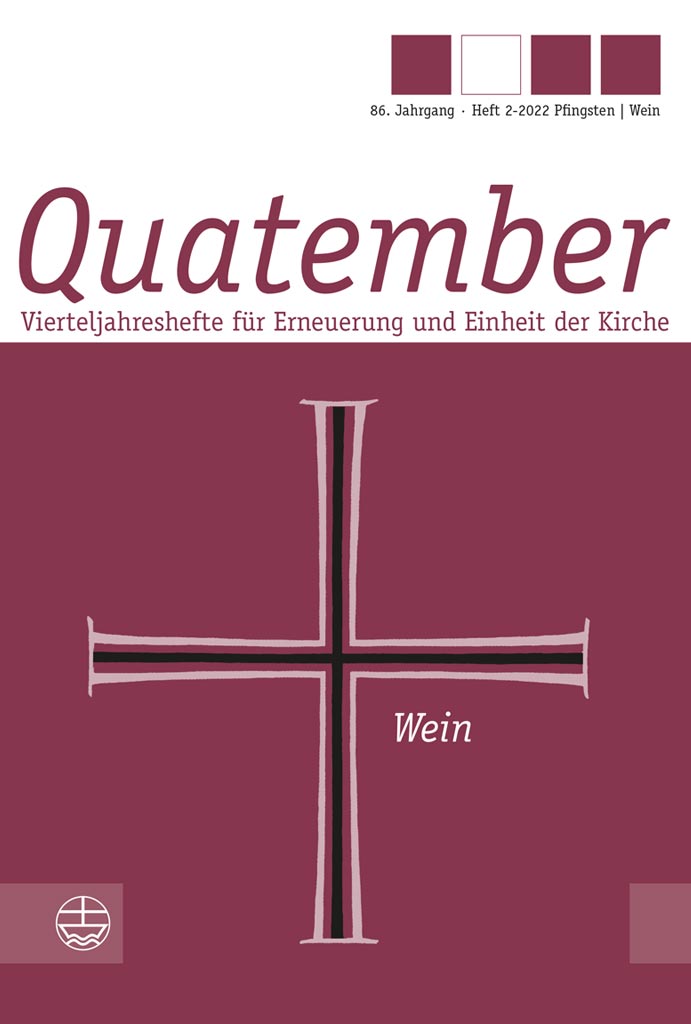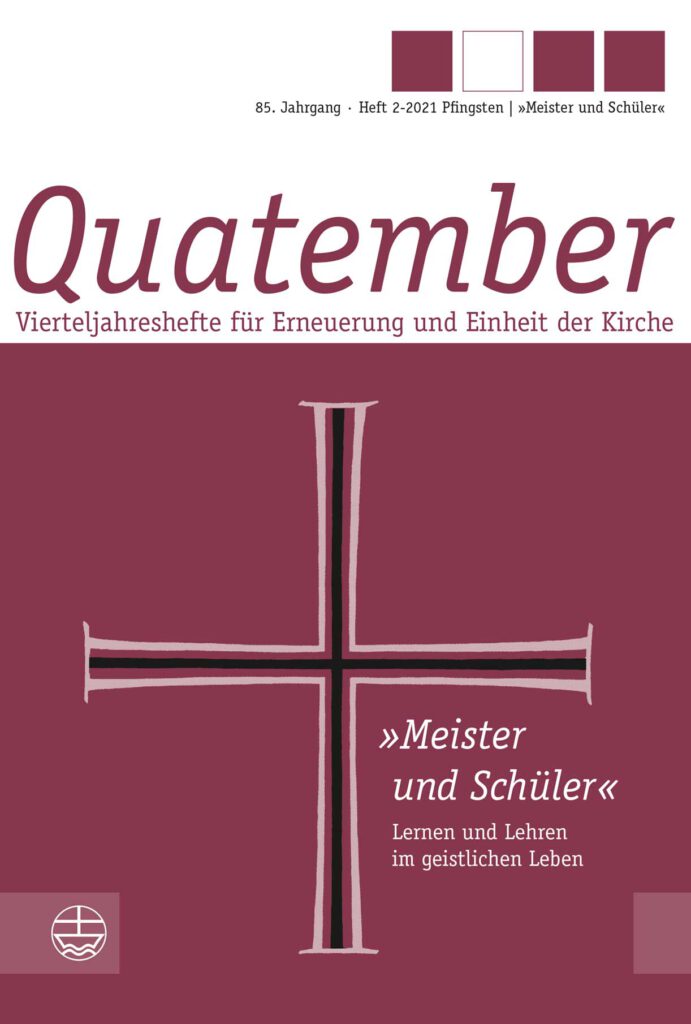
2-2021 | Meister
und Schüler
Inhalt
| Zur Einführung | |
| 142 | Roger Mielke: »Meister und Schüler«. Lernen und lehren im geistlichen Leben |
| Essays | |
| 148 | Horst Folkers: »… wer es lieset, der vernehme es …« Zur Hermeneutik des Evangelisten Markus |
| 159 | Christina Risch: Die Entwicklung der Nachfolge im Neuen Testament |
| 167 | Astrid Giebel: Geistlich lehren und lernen in der Diakonie |
| 178 | Ingrid Vogel: Geistliches Lernen und Lehren |
| 187 | Stephan Sticherling: Die Rolle der Glaubens-Bildung in Kirche und Gemeinde |
| 195 | Gérard Siegwalt: Die Neu(er)findung des Namens Gottes. Wo ist Gott denn hingekommen? |
| 205 | Hermann Michael Niemann: Ein Lehrer der Bruderschaft. Peter Heidrich: Theologe, Philosoph – und ein großer Erzähler (1929 – 2007) |
| 73 | Peter Buchner: Nachtwache |
| 84 | Regina Bailer: Literarische Perlen zur Nacht |
| Stimmen der Väter und Mütter | |
| 210 | Heiko Wulfert: Lernen und Lehren im geistlichen Leben |
| Rezensionen | |
| 222 | Alexandra Dierks: Peter Zimmerling (Hg.), Handbuch Evangelische Spiritualität Bd. 3 Praxis |
| 224 | Heiko Wulfert: Friedemann Richert, Das lateinische Gesicht Europas. Gedanken zur Seele eines Kontinents. Mit einem Geleitwort von Klaus-Peter Willsch. Georgiana. Neue theologische Perspektiven Bd. 4 |
| 226 | Frank Lilie: Thomas A. Seidel und Ulrich Schacht (Hg.), Würde oder Willkür. Theologische und philosophische Voraussetzungen des Grundgesetzes, Georgiana. Neue theologische Perspektiven Bd. 3 |
| 229 | Adressen |
| 230 | Impressum |
»Meister und Schüler«.
Lernen und lehren im geistlichen Leben
von Roger Mielke
Foto: Rolf Gerlach
Echtes Lehren hat man als imitatio eines transzendenten oder, genauer, göttlichen Enthüllungsaktes angesehen, jener Ausfaltung und Einfaltung von Wahrheiten, die Heidegger dem Sein zuschreibt (altheia). (…) Der Lehrer ist nicht mehr, aber auch nicht weniger als ein Hörer und Bote, dessen inspirierte und dann geschulte Empfänglichkeit ihn dazu befähigt hat, einen offenbarten Logos, jenes »Wort im Anfang« zu begreifen. George Steiner, Der Meister und seine Schüler. Lessons of the Master, München, Wien: Hanser, 2004, S. 11
Der Bruder bedenkt, dass man geistliche Erkenntnisse nicht durch bloßes Reden vermitteln kann. Regel der Evangelischen Michaelsbruderschaft, Satz 14
Darum seht euch selber vor; niemand wird für euch die Verantwortung übernehmen: das müsst ihr selber tun. Seht euch vor und nehmt Gottes und seines liebsten Willens wahr und des Rufes, mit dem euch Gott gerufen hat, dass ihr dem folgt. Johannes Tauler, Predigt zum vierten Sonntag nach Ostern, in: Predigten Band I, Einsiedeln: Johannes, 5. A. 2011, S. 112
Neunzig Jahre wird die Michaelsbruderschaft in diesem Jahr alt, gestiftet an Michaelis 1931 in der Kreuzkapelle der Universitätskirche zu Marburg. Anlass genug, sich Rechenschaft zu geben über den Weg der Bruderschaft. Nicht selten begegnet die Meinung, die Berneuchener seien eine Bewegung der liturgischen Erneuerung. Daran ist etwas Richtiges, es trifft aber, denke ich, nicht den Kern. Die Bruderschaft und die mit ihr verbundenen Gemeinschaften sind Gemeinschaften geistlichen Lebens. In Satz 39 der Regel der Bruderschaft heißt es: »Die Bruderschaft ist bemüht, alle ihre Glieder auf einem festen Wege innerer Erfahrungen zu führen und sie so in ihrem geistlichen Leben zu fördern.« Dieses erfahrungsbezogene »führen« und »fördern« ist die Seele bruderschaftlichen Lebens.
Auf meinem persönlichen mittlerweile dreißig Jahre währenden Weg als Michaelsbruder waren es Schlüsselerfahrungen, Brüdern und Schwestern zu begegnen, die mir Lehrerinnen und Lehrer gewesen sind, deren Vorbild ich aneignen, mir anverwandeln konnte. Es ging dabei um Lebensformen, die ich in ihrer Tragfähigkeit für mein eigenes Leben erkunden musste. Nicht alles war mir »förderlich« im oben gemeinten Sinne, aber doch vieles. Ich hatte bedeutende Lehrmeister, die mit liebevoller Geduld den damals jungen Mann mitgenommen, ermutigt und auch zur Kritik eingeladen haben. Ich nenne hier nur einige Namen von schon vollendeten Brüdern: Kurt Abel, Hanfried Moes, Manfred Schnelle. Die Begegnungen mit ihnen initiierten Prozesse geistlichen Lernens. Was ich meine, finde ich in Formulierungen des Erziehungswissenschaftlers Tobias Künkler wieder. In Abgrenzung gegen ein gegenwärtig einflussreiches instrumentelles Konzept des Lernens plädiert Künkler für ein bildungstheoretisch fundiertes relationales Lernverständnis: »… in jedem Lernen (wird) nicht nur etwas gelernt, sondern es ereignet sich zugleich ein Sich-Erlernen wie Welt-Erlernen. Lernen bedeutet dem entsprechend nicht nur eine beobachtbare, nachhaltige Verhaltensänderung, sondern als radikales Beziehungsgeschehen betrachtet, ist der Prozess des Lernens eine Verschiebung im Ineinander des Relationsgefüges und resultiert darin, dass man sich zu etwas oder jemandem verändert verhält.«1 Lernen und Lehren im geistlichen Leben lässt sich in diesem Horizont als ein lebenslanger Prozess der Veränderung und Reifung beschreiben, einerseits als Einweisung und Initiation in einen geprägten Raum, in eine Art kanonischer Tradition, andererseits aber auch als Einweisung und Initiation in das unvertretbar eigene Leben, als Selbst-Werden, als Weg, auf dem das erst ausgearbeitet wird und erscheint, »was wir sein werden« (1 Joh 3,2).
Diese Art von Einweisung und Initiation in geistliches Leben kann nicht aus Büchern gelernt werden, vermutlich auch nicht einfach in zertifizierten »Kursen«. Geistliches Lernen bedarf der Begleitung und Anleitung durch eine Person, die den geistlichen Weg selbst erkundet und erprobt hat, die mit Wegen und Abwegen, Gründen und Abgründen vertraut ist. Dies ist der geistliche Meister oder die Magistra: Sie oder er tritt in Beziehung ein, als Vorbild, als Anerkennender, als Begehrter – um Veränderung zu ermöglichen, nicht um sie kausal oder gar instrumentell zu bewirken. Der Meister wirkt auch durch Provokation, durch die Energie zum Widerspruch, der nötig ist, um den eigenen Weg der personalen Reifung zu finden. In diesem Reifen erst entbirgt sich die Gottesbeziehung als das letztlich fundierende und umgreifende Geheimnis des eigenen Lebens und der Welt im Ganzen. Daher ist geistliches Lehren und Lernen immer in das Ganze des eigenen Lebenszyklus (oder der Lebenslinie) eingebettet: Leben lernen und Sterben lernen gehören zusammen.
Der Meister ist derjenige, an dem das Geheimnis Gottes und des Lebens einleuchtet und aufleuchtet, als an einer ausdrücklichen und eindrücklichen Lebensgestalt. Der Apostel Paulus schreibt: »Symmimetai/Mimetai mou ginesthe« (1 Kor 11,1; Phil 3,17). In der Lutherübersetzung dieser Verse wird die personale Dimension ganz verdünnt: »Folgt meinem Beispiel wie ich dem Beispiel Christi.« Das Griechische des Neuen Testaments dagegen drückt es ganz personal aus: »Werdet meine Nachahmer.« Im paulinischen Horizont ist Mimesis (lat. imitatio) ein christologisches Konzept. Der »Typos« oder das »Vorbild« in Phil 3,17 ist letztlich Jesus selbst, der sich, wenn und wo er angeschaut wird, dem Leben einprägt. Nach Mt 23,8 ist Er der eine Rabbi/Meister und Didaskalos/ Lehrer, dem nachzufolgen die Seinen gerufen sind. Wenn dieser christologische Ursprung der Meisterschaft ernst genommen wird, wird deutlich, dass jede Autorität des Lehrmeisters abgeleitet und rechenschaftspflichtig ist. Andererseits erklärt sich auch manche Reserve gegenüber der Vorstellung des »Lehrmeisters « überhaupt. Sie ist und bleibt mit manchen Ambivalenzen behaftet. Die Missbrauchsskandale in klerikalen Milieus nicht nur römisch-katholischer Provenienz deuten auf den tiefen Revisionsbedarf der machtaffinen traditionellen Konzepte. In seinem Buch »Lessons of the Master« ist der Literaturwissenschaftler George Steiner dieser Spur der Ambivalenzen in den Lehrer-Schüler- Beziehungen auf großartige Weise gefolgt. Am Ende seines von Sokrates und Alkibiades bis hin zu Husserl und Heidegger reichenden Werkes stellt er die Frage »Szientismus; Feminismus; die Massendemokratie und ihre Medien. Können die ›Lehren der Meister‹ ihren gewaltigen Ansturm überstehen, sollten sie es überhaupt? Ich glaube, sie werden es, und sei es auch in unvorhersehbarer Gestalt. Ich glaube, sie müssen es.«2 Die gleiche Frage ist auch zu stellen mit Blick auf künftige Gestalten des geistlichen Lebens. Wir werden die Antworten der Tradition nicht wiederholen können. Wir werden sie neu zu formulieren haben, in den Berneuchener Gemeinschaften, in der Kirche insgesamt.
Damit zu den Beiträgen dieses Heftes. Horst Folkers, Philosoph aus Freiburg und Michaelsbruder im Konvent Oberrhein, gibt eine Probe seines kommenden Buches über die Hermeneutik der Evangelien. Er rekonstruiert, für geistliches Lernen und Lehren höchst bedeutsam, im Markusevangelium eine »Theorie des Nichtverstehens«, ein aufgehaltenes Verstehen, das sich dem ganzen Weg Jesu bis hinein in Tod und Auferstehung stellen muss, um am Ende, angesichts des rational nicht Assimilierbaren von Kreuz und Auferstehung, »beim Unverständlichen aufmerksam auszuharren«.
Christina Risch, Neutestamentlerin an der Universität Koblenz, entfaltet eine in gleicherweise vorösterliche wie nachösterliche Theologie der Nachfolge, in welcher der messianische Weg eines radikalen Hinausgerufenwerdens einmündet in eine christologischpneumatologische Lebensform der Freiheit, die alle irdischen Abhängigkeiten relativiert zugunsten eines geduldigen Fragens nach dem Willen Gottes in den jeweiligen Lebensumständen.
Astrid Giebel, Theologische Assistentin des Vorstands der Diakonie Deutschland in Berlin, beschreibt in ihrem Beitrag die Bemühungen um eine geistlich geprägte Unternehmenskultur in diakonischen Werken und Unternehmen, in denen vielleicht nur noch eine Minderheit von Beschäftigten der Kirche angehört. Aufschlussreich ist, wie es im Bereich von Medizin und Pflege zu einer neuen Wertschätzung von Spiritualität kam, die von Mitarbeitenden wie von kranken oder pflege- und unterstützungsbedürftigen Menschen als eine wichtige Ressource für Lebenssinn entdeckt wird.
Ingrid Vogel, langjährige Pfarrerin in Wien und Vorsitzende von »pro ecclesia – FÜR DIESE KIRCHE«, bettet die Erfahrungen auf dem Weg der Berneuchener Gemeinschaften ein in vielfältige ökumenische Traditionsbezüge. Monastische Quellen, reformatorische Gebetsliteratur, orthodoxes Herzensgebet werden gegenwärtig, wo Rechenschaft gegeben wird über geistliches Lernen und Lehren. Geistlich lehren, so betont Ingrid Vogel, braucht zwar immer das Gegenüber von Lehrenden und Lernenden, lebt aber letztlich von einer Lerngemeinschaft, die dieses Gegenüber umgreift.
Stephan Sticherling, rheinischer Michaelsbruder und bis zum vergangenen Jahr Pastor am Altenberger Dom, betont die ekklesiologische Dimension der Glaubensbildung. In Aufnahme des Begriffs der »Atmosphäre« aus der phänomenologischen Philosophie von Hermann Schmitz und des praxeologischen Habitus- Begriffes von Pierre Bourdieu fragt Stephan Sticherling nach der Körpersprache und der Ausstrahlung von Kirche, die immer Raum für die Einübung des Glaubens geben müsse und erst dadurch, nicht etwa durch ambitionierte Werbeprogramme, eine Anziehungskraft gewinne, die zum Glauben ermutigt.
Gérard Siegwalt, Elsässer Michaelsbruder und langjähriger Professor für Systematische Theologie an der Universität Straßburg, ist selbst einer der großen Lehrer der Michaelsbruderschaft. In beeindruckender Weise entfaltet er, selbst im neunten Lebensjahrzehnt stehend, ein leidenschaftliches Plädoyer für eine »Neu(er) findung des Namens Gottes«, die einerseits aus den Erfahrungen der, auch interreligiös verstandenen, Tradition erwachsen muss, andererseits aber »von unten« anheben muss, aus einem solidarischen Mit-Erleiden der Nöte und Ratlosigkeit unserer Zeit.
Hermann Michael Niemann, Michaelsbruder im Konvent Norddeutschland und Alttestamentler an der Universität Rostock, erinnert an einen der bedeutenden Lehrer der Bruderschaft, an Peter Heidrich, der hier stellvertretend steht für viele Brüder und Schwestern, die Wegweiser für andere waren und sind. Der Rostocker Theologe und Religionswissenschaftler Peter Heidrich war zu DDR-Zeiten eine Person, die vielen suchenden Menschen Orientierung gab, von den Behörden allerdings misstrauisch beäugt.
Heiko Wulfert, Pfarrer in Aarbergen bei Limburg, Ältester des Konvents Hessen der Michaelsbruderschaft und Sekretär des Arbeitskreises Theologie und Ökumene, spannt von Johann Amos Comenius bis hin zu Wilhelm Stählin einen großen Bogen mit kommentierten Texten zu geistlichem Leben und geistlichen Bildungsprozessen. Gerade Zeugnisse wie diejenigen von John Wesley oder Johann Hinrich Wichern weisen darauf hin, dass geistliches Lehren und Lernen immer auch eine auffallend hohe soziale und politische Wirksamkeit entfaltet hat.
Das Heft schließt mit drei Rezensionen. Alexandra Dierks, Militärpfarrerin in Wunstorf und Begleitende Pastorin des Ordo Pacis, rezensiert den dritten Band des von Peter Zimmerling herausgegebenen Handbuchs Evangelische Spiritualität. Heiko Wulfert rezensiert »Das lateinische Gesicht Europas« von Friedemann Richert, Frank Lilie den von Thomas A. Seidel und Ulrich Schacht herausgegebenen Band »Würde oder Willkür. Theologische und philosophische Voraussetzungen des Grundgesetzes«. Die beiden letztgenannten Bände sind in der Reihe der Veröffentlichungen der Evangelischen Bruderschaft St. Georgsorden erschienen und verdienen schon daher besonderes Interesse.
Geistesgegenwart auf dem lebenslangen Weg des geistlichen Lernens und Lehrens, und möglicherweise die eine oder andere Inspiration dazu aus den Beiträgen dieses pfingstlichen Quatemberheftes wünscht
Ihr Roger Mielke

1 Tobias Künkler, Skizze einer relationalen Lerntheorie, S. 24, in: Imago. Zeitschrift für Kunstpädagogik, 2015.01, S. 19 – 28.
2 George Steiner, Der Meister und seine Schüler. Lessons of the Master, München, Wien: Hanser, 2004, S. 203.
»… wer es lieset,
der vernehme es …«
Zur Hermeneutik des Evangelisten Markus
von Horst Folkers
I. Einleitung. In welchem Sinne von einer Hermeneutik des Markus-Evangelisten die Rede sein soll
Meiner Untersuchung will ich die Hypothese zugrunde legen, dass Markus nicht nur ein reflektiertes Interesse daran hat, die Botschaft des aramäisch sprechenden Jesus in die Weltsprache Griechisch zu übersetzen, sondern dass er auch ein tiefes und vielseitiges Verständnis für die Schwierigkeit hat, das Göttliche des Seins und der Botschaft Jesu in menschliche Worte zu fassen. An einigen Stellen zeigt Markus ausdrücklich, dass er über eine wohlüberlegte Anschauung seiner Übersetzungs- und Auslegungsarbeit, also über eine Hermeneutik verfügt. Die Schwierigkeit zu verstehen, was es mit diesem Manne, Jesus von Nazareth, auf sich hat, ist Markus zuletzt ein Anstoß geworden, überhaupt sein Werk zu verfassen. Wie sehr immer die schriftliche Aufzeichnung der Jesustradition Ende der sechziger Jahre in der Luft lag, so hat doch Markus als Erster in einer immer noch erregenden Form es vermocht, den ungeheuren Widerspruch zwischen der Freiheit des geliebten Gottessohnes Jesus von Nazareth und seinem schmählichen Ende am Kreuz in ein erzähltes Ganzes zu bringen.
Markus macht insbesondere die Schwierigkeit, die Sendung Jesu zu verstehen, zum Thema, er hat, wenn man so will, eine Theorie des Nichtverstehens. Das Nichtverstehen bestimmt insbesondere den zweiten Teil des Markusevangeliums (4,35–8,26), *1 im dritten Teil (8,27–10,52) wird seine Tiefe enthüllt, indem Jesus sein Leidenmüssen verkündigt. Er, der Messias, der zu nichts anderem gekommen ist, als das Reich Gottes aufzurichten, also dem Leben zu seiner Fülle zu verhelfen, soll leiden müssen, ja getötet werden – das verstehe, wer will. Während der vierte Teil (11,1–13,37), der die drei ersten Tage Jesu in Jerusalem berichtet, eine Atempause des Schwerverständlichen bringt, indem die souveräne Art Jesu, im Tempel seine Gegner zu meistern und sein messianisches Amt in höchster Klarheit darzustellen, dem durch alle Zeiten Verständlichen der Botschaft Jesu angehört, enthält der fünfte Teil (14,1–16,8) als Schluss des Evangeliums in harter Fügung die Katastrophe. Sie wird durch die Reihe der offenbaren Fakta gleich einem unvermeidlichen Geschehen erzählt. Im Innern ist diese Erzählung jedoch von einer sich steigernden Unruhe des Unverständlichen bewegt, die schließlich gekrönt wird von dem, wenn man so sagen darf, schlechthin Unverständlichen, der Auferstehung des Gekreuzigten, dem Sieg des Lebens über den Tod mitten in der Weltzeit, der in der Erfahrung aller Menschen aller Zeiten kein Analogon hat.
II. Der Raum der Schrift
Nach der Hermeneutik des Markus soll zunächst in Hinblick auf die Differenz von Reden und Schreiben gefragt werden. Markus bedauert nicht, die Mündlichkeit Jesu zu verlassen, er will, dass das Evangelium Schrift wird. Er geht auf die überlieferten heiligen Schriften zurück und bestimmt das Evangelium für Leser, denen er es in reflektierter Weise schriftlich erzählen will. Auch ein Leser hört, was er liest, aber er ist nicht wie der unmittelbare Hörer durch den Fluss der Rede gefangen, er kann dem im Lesen Gehörten nachhorchen, es noch einmal hören. Weil er nicht auf eine fremde Stimme hört, kann er sich leichter ganz auf die Sache, die gesagt ist, einlassen. Er kann sie sorgfältig erwägen und mit zuvor und anderswo Gehörtem, das heißt vor allem Gelesenem, vergleichen, sich ihrer Stimmigkeit und Wahrheit vergewissernd. Deshalb ist der Leser dem Schreibenden eine Instanz, die ein Urteil über sein Tun hat. Wer schreibt, muss auf jedes Wort, das er dem Leser sagen will, Acht haben, zumal dann, wenn die Lesekundigen, wie zur Zeit Jesu, sich längst zu einem eigenen Stand, dem der Schriftgelehrten, der grammatei’~, ausgebildet haben. Sie erwähnt Markus schon beim ersten Bericht über den in der Synagoge in Kapernaum lehrenden Jesus, Mk 1,21, in dem er die Lehrart der Schriftgelehrten der jesuanischen entgegensetzt.
Die Leute, die Jesus hörten, »entsetzten sich über seine Lehre, denn er war, sie lehrend, wie einer, der Vollmacht hatte, und nicht wie die Schriftgelehrten – ejxeplhvssonto ejpi; th’/ didach’/ aujtou‘: h\n ga;r didavskwn aujtou;“ wJ“ ejxousivan e[cwn kai; oujc wJ“ oiJ grammatei`~«, Mk 1,22. Kein Wort teilt Markus über das mit, was Jesus lehrte – worauf es doch allein ankommen kann –, allein die Wirkung seiner Lehre auf die Hörenden, die nur ihr Gefühl, ihr Entsetztsein nennt, scheint Markus von Bedeutung.
Das lässt sich als Element der Erzählkunst des Markus verstehen, indem die Neugier des Lesers auf eine ihm noch unbekannte Lehre von so eindrucksvoller Wirkung geweckt wird. Diese Anleitung zu lesen, hat eine hermeneutische Seite. Die Zuhörer Jesu, die unmittelbar von seiner Rede Betroffenen, waren entsetzt, der Leser aber muss sich nicht erregen, er darf und soll vielmehr erwägen, was ihm berichtet und gesagt wird. Auf sein Verständnis, nicht auf seine Erregung kommt es an. So schreibt jemand im Bewusstsein des Gewichts dessen, was er zu sagen hat. Von Anfang an ist es Markus um das Verständnis des kundigen Lesers zu tun. Die drei größten Leser, die er gefunden hat, haben ihre weltgeschichtliche Bewährung schon hinter sich, Lukas, Matthäus und Johannes.
Markus steht mit seiner Schrift, die er selbst Evangelium nennt (1,1), wie jeder Schriftsteller im Traditionsraum der ihm überlieferten Literatur. Doch nicht die klassische griechische Literatur ist Grundlage seiner Schrift, sondern die Septuaginta, eine im 3. Jahrhundert v. Chr. begonnene Übersetzung *2 der hebräischen Bibel ins Griechische. Die Septuaginta ist die bedeutendste Transferleistung der älteren antiken Geschichte vor dem Transfer der griechischen Sprachwelt in das Lateinische durch die ciceronische Klassik und ihre Folgen. Mit der Septuaginta werden die Heiligen Schriften Israels mit ihrem ebenso durchdachten wie erfahrenen Monotheismus in der Weltsprache des Griechischen, in der heidnischen Welt der Vielgötterei und der Mysterien, die zugleich die Welt überlegener Zivilisation, Kunst und Wissenschaft ist, zugänglich. Die Septuaginta ist derart Boden und Sprachraum des Markusevangeliums, dass ohne sie dieses Evangelium undenkbar ist. Mit Entschiedenheit nimmt Markus von Anbeginn seines Evangeliums die Sprachwelt der Septuaginta auf. Sein erstes Wort »Anfang – ajrchv«, Mk 1,1, ist das zweite Wort der Septuaginta, die den Schöpfungsbericht mit den Worten »ejn ajrch’/ ejpoivhsen oJ qeo~;« – im Anfang schuf Gott«, Gen 1,1, beginnt. Bei Markus aber ist dieser Anfang der »Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes – ajrch; tou‘ eujaggelivou jIhsou‘ Cristou‘ uiJou‘ qeou‘«, und der wiederum ist, wie Markus hier ge.lesen sein will, der Anfang, »wie er geschrieben steht bei Jesaja, dem Propheten – kaqw;“ gevgraptai ejn tw’/ jHsai>va/ tw’/ profhvth/«, Mk 1,2. *3 Markus identifiziert sein erstes Wort, den Anfang, und die ihm folgenden Worte mit dem, was bei Jesaja geschrieben steht. Eigentlich hat Jesaja zuerst den Anfang des Evangeliums von Jesus Christus aufgeschrieben. Das Zitat mit den Worten des Propheten Jesaja aus der Septuaginta ist nicht, wie damals üblich, stillschweigend für die Kenner unter den Hörern eingeführt, sondern ausdrücklich auch für Unkundige namhaft gemacht, indem der Prophet Jesaja genannt wird, womit Markus zugleich den für sein Evangelium wichtigsten Zeugen der Messianität Jesu einführt. Markus anerkennt die Verbindlichkeit dieser, zu seiner Zeit bereits kanonisch gewordenen, Heiligen Schriften Israels, er lebt von ihrer Sprachwelt, ihrer Erzählkunst, ihren Gebeten, und es wird erlaubt sein zu fragen, ob er mit seinem Evangelium nicht Teil dieses Raumes werden will. Als Markus schrieb, lagen zwar die meisten kanonischen Schriften der hebräischen Bibel in ihrer endgültigen Form vor, allein der Kanon selbst war noch nicht abgegrenzt, es gab umstrittene Schriften. Ein Schlussstein ließe sich den Heiligen Schriften noch anfügen, einfügen, eine Schrift, die von Gottes Sohn, dem Messias erzählt, der gekommen ist, das Reich Gottes aufzurichten, Gottes letztes Wort. Markus könnte den Anspruch gespürt haben und von ihm getragen worden sein, sein Evangelium als den alten Heiligen Schriften zugehörig, als ihre Vollendung zu schreiben. Vielleicht ist die Inspirationslehre der frühen Kirche aus solchen Einsichten erwachsen.
Aber nicht alles hat Markus aus der Septuaginta, erstaunlich kreativ geht er mit der Sprache um und betont die besondere Art seines Griechisch, indem er mehr Aramaismen und Latinismen als alle anderen neutestamentlichen Schriften in ihm unterbringt, ja mehr Aramaismen als überhaupt eine uns überlieferte griechische Schrift. Damit wird in seinem Griechisch zugleich das Fremde mithörbar. Die fremde Sprache, aus der übersetzt, aber manchmal auch zitiert wird, bestimmt als solche den Text mit. Kenntnisse lateinischer Benennungen setzt er bei seinen Lesern voraus, der Hauptmann, der centurio ist ein kenturivwn, Mk 15,39, die Münze Quadrant ein kodravnth“, Mk 12,42. An vier Stellen seiner Schrift übersetzt Markus ausdrücklich eine aramäische Wendung, drei.mal benutzt er dabei das griechische Wort für übersetzen, das meqermhneuvein, Mk 5,41; 15,22.34, vgl. auch Mk 7,34. Zum Töchterlein des Jairus sagt Jesus »talitha kum, das ist übersetzt: Mädchen steh auf – taliqa koum, o{ ejstin meqermhneuovmenon: to; koravsion… e[geire«, Mk 5,41. Zum Taubstummen sagt er »ephata, das ist, tu dich auf – efaqa, o{ ejstin dianoivcqhti«, Mk 7,34. Von Golgotha wird gesagt, es heiße übersetzt Schädelstätte, Mk 15,22, und schließlich ruft Jesus am Kreuz die Worte »eloi eloi lema sabachthani – elwi elwi lema sabacqani«, Mk 15,34, das heißt übersetzt »mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen«. Indem Markus im übersetzten Wort nach seiner Bedeutung in der fremden Sprache fragt, gibt er ein Beispiel seiner hermeneutischen Kunst. Den aramäischen Originalton gebend, macht er nicht nur auf Authentizität Anspruch, sondern betont zugleich das Nichtselbstverständliche des Verstehens und macht seinen griechischen, des Aramäischen unkundigen Leser auf seine Übersetzungsarbeit aufmerksam. Nicht gleich und auf einmal geschieht in solchen Fällen Verstehen, es ist ein Weg zurückzulegen, eine Vermittlung muss geschehen, der Leser braucht den Dolmetscher, den Markus zu geben bereit ist. Es sind aber diese wenigen Übersetzungsstellen in seinem Evangelium Pars pro Toto, ein Teil, der für das Ganze steht. Denn es geht um die Kunst des aufgehaltenen, erst auf einem Umweg zum Ziel kommenden Verstehens, in die Markus in solchen Stücken seine Leser einübt.
III. Eine Annäherung an das Unverständliche
1. Lesen und Schriftverständnis
Markus widmet dem Nichtverstehen eine betonte, wiederholte Aufmerksamkeit. Die Frage legt sich, wie schon gesagt worden ist, nahe, ob er eine Theorie des Nichtverstehens hat und welche Zwecke er mit ihr verfolgt.
In Jesu Gleichnis von den bösen Weingärtnern findet sich ein Lesen und Nichtverstehen. Am dritten Tag in Jerusalem, dem Tag seiner großen Lehre im Tempel, wird Jesus von allen dafür Zuständigen, den Hohepriestern, den Schriftgelehrten und den Ältesten, nach seiner Vollmacht gefragt, Mk 11,28. Er antwortet indirekt, indem er eine Parabel von den bösen Weingärtnern erzählt. Sie erschlagen schließlich den geliebten einzigen Sohn des Herrn des Weinbergs. Dann sagt Jesus: »Habt ihr nicht diese Schrift gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen«, Mk 12,10.11. Natürlich hatten alle diese Stelle der Schrift gelesen, sie hatten sie aber nicht auf Jesus bezogen, wie er es tut, indem er zunächst der von den Bauleuten verworfene Stein ist, der dann vom Herrn zum Eckstein erwählt wird. Recht verstehen ist hier nicht mehr davon zu trennen, die Vollmacht Jesu als des Sohnes recht zu begreifen. Die Lesung der Schrift lässt erblinden, als wäre sie nicht gelesen, wer des Sohnes Sein von Gott her nicht versteht.
Nicht unmittelbar um ihn, sondern um die Auferstehung geht es an einer zweiten Stelle im selben Streitgespräch im Tempel. Die Sadduzäer, welche die Auferstehung leugnen, da sie meinen, sie sei in der Thora nur schwach bezeugt, erzählen eine verzwickte Geschichte, wie es nach der Auferstehung mit den irdischen Dingen der Auferstehenden weitergehen soll. Jesus stellt ihnen, ironisch?, eine Gegenfrage: »Irrt ihr nicht deswegen sehr, weil ihr weder die Schriften kennt noch die Kraft Gottes – ouj dia; tou`to plana`sqe mh; eijdovte“ ta;“ grafa;“ mhde; th;n duvnamin tou` qeou` …«, Mk 12,24. Dann zitiert er wiederum die Schrift: »Habt ihr nicht gelesen im Buch des Moses am Dornbusch, wie Gott zu Mose spricht: Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs«, Mk 12,26. Das hatten sie wohl gelesen, das wussten sie schon als Kinder auswendig, was sie aber nicht wussten, ist der Schluss, der von der Kraft Gottes her aus dieser Stelle zu ziehen ist. Denn der lebendige Gott kann kein Gott der Toten, sondern nur der Gott der Lebendigen sein. So sind diese Väter des Glaubens, ob sie gleich gestorben und begraben sind und man ihre Gräber kennt, dennoch bei Gott, der sich zu ihnen bekennt und ihr Gott geblieben ist, lebendig, wie nur Auferstandene bei ihm lebendig sein können. In dieser Auslegung Jesu verbinden sich vollkommenes Wörtlich-nehmen der Thora mit einem uneingeschränkten Vertrauen in die Kraft Gottes. Man könnte seine Auslegung dieser Stelle und seine Schlussfolgerung als Modell verstehen, wie das Evangelium des Markus selbst verstanden sein will.
Markus schreibt in Hinblick auf einen Leser, dessen naives Verständnis er zu einem reflektierten erheben möchte, er schreibt hermeneutisch im Bewusstsein der Übersetzungsleistung des Geschriebenen und der durch die Schrift eröffneten Verstehensmöglichkeiten. Da das Wesentliche dessen, was er von und über diesen Mann aus Nazareth mitzuteilen hat, schwer verständlich ist, sucht Markus nach Möglichkeiten, die Auslegungskunst der Leserin anzuregen und zu entwickeln, auch in diesem Sinn schreibt er hermeneutisch.
2. Theorie des Nichtverstehens
Ein wesentliches Stück der Hermeneutik des Markusevangeliums ist seine Theorie des Nichtverstehens. Markus entwickelt sie im zweiten Teil seiner Schrift, 4,35–8,26, dem Teil der Abenteuer Jesu und der Seinen in der Wirrnis der Welt, er legt ihren Grund und ihr Prinzip im dritten Teil, Mk 8,27–10,52, dar, dem Teil der Leidensankündigung und Leidensübernahme Jesu. Er inszeniert ihren Höhepunkt im fünften und letzten Teil, Mk 14,1–16,8, durch die undurchdringliche Faktizität des Unverständlichen wie durch die sich jedem einfachen Aufschluss verweigernde Theologie des stillschweigenden Geschehens zwischen Vater und Sohn.
a. Grund und Prinzip des Nichtverstehens
Der dritte, mittlere Teil des Markusevangeliums beantwortet gleich anfangs die Frage, wer Jesus ist: Er ist der Messias. So bekennt ihn Petrus, Mk 8,29. Damit hat sich Jesus als der Verheißene, als die endzeitliche Heilsgestalt offenbart, die auch unter dem Namen des königlichen Davidssohnes, der das Reich wieder aufrichtet, des Königs Israels, Mk 15,32, erwartet wurde. Gewiss war, dass dieser Heilsbringer, heiße er nun Messias oder Davidssohn, Israel erlösen würde, indem er das Reich Gottes aufrichtet. Gerade an dieser Stelle macht Jesus nun ernst mit der Lehre und lehrt, »dass notwendig sei, dass der Menschensohn vieles leiden müsse – o{ti dei` uiJo;n tou` ajnqrwvpou polla; paqei`n«, Mk 8,31. Das hatte niemand wissen und voraussehen können. Denn was Jesus bisher, im ersten und zweiten Teil des Evangeliums, getan hat, Mk 1,1–8,26, war klar: Er bringt die leidende Welt wieder zurecht, so gut es an Ort und Stelle geht, er heilt die Kranken, er speist die Hungrigen, er lehrt das Wort, er stillt den Sturm. Das Leiden ist draußen, und Jesus, der Heiland, ist der große Arzt. So kommt ihm das Lob aus Volkes Munde zu, »gut hat er alles gemacht und die Tauben hat er hörend und die Stummen sprechend gemacht«, Mk 7,37. Aber nun, im dritten Teil, Mk 8,27–10,52, tritt er, sein Schicksal vorwegnehmend, dem Leiden nicht mehr gegenüber, er stellt sich selbst unter das Leiden, er nimmt das Leiden auf sich, er ist der Leidende. Er wird vieles leiden, er wird verachtet und getötet werden und am dritten Tage auferstehen nach einer Notwendigkeit, von der er nichts weiter sagt, als dass sie da ist. Der gesamte dritte Teil ist von dieser Leidenseinsicht geprägt, ihm nachfolgen heißt von nun an, »sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen«, Mk 8,34. Die Nähe der Kinder zum Gottesreich, die Hinderlichkeit des Reichtums, um in das Reich einzugehen, das Ethos des Dienens statt des Herrschens, all das sind Folgen der Übernahme des Leidens durch den Messias. Aber wer will denn, dass ausgerechnet der, der die Leidenden heilt und kraft seines Amtes, das Reich Gottes zu bringen, auch heilen soll und kann, selber leidet? Petrus jedenfalls spürt die außerordentliche Zumutung, die darin besteht, dass der, von dem man Erlösung vom Leiden erwartet, nun selbst leiden und sterben soll, indem er Jesus zur Seite nimmt und ihm Vorhaltungen macht. Jesus aber gibt ihm kräftig zurück und sagt, »mach dich fort hinter mich, Satan, denn du denkst nicht, was Gottes, sondern was der Menschen ist – u{page ojpivsw mou, satana`, o{ti ouj fronei`“ ta; tou` qeou` ajlla; ta; tw`n ajnqrwvpwn«, Mk 8,33. Das ist der unüberbietbare Höhepunkt der Zurückweisung der Jünger durch Jesus selbst wegen ihres Nichtverständnisses. Das eigentlich Unverständliche ist der leidende Messias, von ihm her fällt ein Licht auch auf das Brot, das Jesus seinen Jüngern mit den Worten geben wird »das ist mein Leib«, Mk 14,22, der Leib des am nächsten Morgen Gekreuzigten.
Die Unmöglichkeit der Vorstellung eines leidenden Messias, der freiwilligen Übernahme von Leiden, ist der Kern des Nichtverstehens. *4 Hiob leidet, aber nicht freiwillig. Der späte Jesaja weiß etwas von einem Gottesknecht, der für fremde Schuld leidet, aber der hat nach dem Wissen Israels mit dem Messias nichts zu tun. Nicht die Sündenvergebung und die Zuwendung zu den Sündern, nicht die machtvollen Wundertaten Jesu sind der eigentliche Stein des Anstoßes und des Nichtverstehens auch derer, die ihm nahe sind, es ist die Leidensübernahme in der Voraussage seines eigenen Leidenmüssens. Was die Jünger nicht verstehen – und was wir nicht verstehen –, ist von nun an der leidende Messias. Jesus aber zeigt mit messerscharfer Logik das Prinzip des Unverständnisses des Petrus auf. Petrus versteht nicht, weil er menschlich denkt; was Jesus sagt, verlangt aber göttlich gedacht zu werden. Menschlich gedacht ist es richtig, vom Messias zu erwarten, dass er nicht leide, sondern dem Leiden entgegentrete, göttlich aber ist es, den Messias als den zu begreifen, der vieles leiden muss. In Gottes Wille und Vorsehung liegt das Prinzip unseres Unverständnisses, das ist die Logik, die Jesus dem Hörer und Leser abfordert.
c. Kreuz und Auferstehung
Der letzte und zugleich höchste Punkt des Schwerverständlichen, vor das uns das Evangelium des Markus stellt, liegt im Schlussteil seines Buches, Mk 14,1–16,8. Nach Jesu Abschied vom Tempel und einer kurzen ahnungsvollen Szene wird der Schlussteil mit einem Paukenschlag eröffnet, der die Katastrophe auslöst. »VND Judas Jscharioth / einer von den Zwelffen / gieng hin zu den Hohepriestern / das er jn verrhiete«, Mk 14,10. Nichts, aber auch gar nichts hat der bisherige Bericht des Markus, hat insbesondere der gerade vorübergegangene Teil der souveränen Lehre Jesu im und außer dem Tempel dazu beigetragen, diesen Verrat vorzubereiten. Niemals zuvor war von Judas als Handelndem die Rede, nur ein einziges Mal wurde er erwähnt, als letzter der zwölf Jünger, allerdings sogleich mit dem Epitheton, »der ihn verriet«, Mk 3,19. Aber mehr weiß der Leser des Evangeliums bisher nicht über ihn.
Markus achtet sorgfältig darauf, die spätere Gefangennahme Jesu, aus der die Kreuzigung folgt, präzise auf nur zwei Umstände zurückzuführen. Zum einen auf den Verrat, der allein eine nächtliche Aktion gegen Jesus ermöglicht. Die Nacht ist der Religionsobrigkeit willkommen, da sie sich eine Aktion gegen Jesus bei hellem Tage des Volkes wegen nicht zutraut. Der andere Umstand ist der, dass Jesus, seinem Gebet in Gethsemane folgend, darauf verzichtet, sich durch Flucht der Gefangennahme zu entziehen. Er bleibt im Garten Gethsemane, dort, wo er nach Kenntnis des Judas bleiben wollte, er entzieht sich nicht. So konnte er von den Häschern gefunden werden, und insofern ist der Verrat des Judas sogar die einzige Ursache der späteren Kreuzigung. Aber was ist der Grund eines, dieses Verrates? Keine Antwort ist auf solche Frage. Aus dem Grundlosen oder Abgründigen stammt der Verrat. Jesus sagt dazu: »Wehe dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird, gut wäre es diesem, wenn nicht geboren wäre jener Mensch«, Mk 14,21. So tief geht das Unverständnis dem Verrat gegenüber, dass nicht geboren zu werden besser wäre, als Verräter zu sein. Aber niemand verantwortet, geboren worden zu sein, nicht geboren werden ist nur möglich, wären Adam und Eva ohne Kinder geblieben. Es ist in diesem Verrat eine Kraft, wo möglich die Schöpfung zu verhindern. Damit aber wäre das Feld abgeräumt, auf dem Verstehen und Nichtverstehen sinnvoll unterschieden werden können. Noch in einer weiteren Hinsicht geht der Verrat in seiner Grundlosigkeit merkwürdig tief: Er entwurzelt alle Jünger in ihrer freiwilligen Treue. Denn als Jesus den Verrat ansagt, antwortet ihm ein jeder der zwölfe, »doch nicht ich? – mhvti ejgwv …«, Mk 14,19. Einer um den anderen. Keiner ist sich seiner selbst mehr gewiss, wenn einer unter ihnen Verräter ist.
Als Jesus gefangen genommen ist, fliehen sie alle, »und ihn verlassend flohen sie alle – kai; ajfevnte“ aujto;n e[fugon pavnte“«, Mk 14,50. Das ist der Auftakt zu Jesu letztem Wort am Kreuz: »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?«, Mk 15,34. Kein größerer Schmerz geschieht dem Frommen, der Gott mit all seiner Kraft liebt, als von Gott verlassen zu sein, der Fromme hier aber ist der geliebte Sohn, der ihn verlassen hat, der Vater. Wir sind im Herzen des Unverständlichen. Als wollte Markus gerade darauf hinweisen, berichtet er, dass Jesus seine letzten Worte »mit starker Stimme – fwnh`/ megavlh//«, Mk 15,34, ausruft, teilt ausdrücklich mit, wie diese Worte in der allen Dabeistehenden verständlichen aramäischen Sprache lauten, um dann fortzufahren, dass einige ihn missverstehen. »Sieh, er ruft den Elias«, Mk 15,35, meinen sie gehört zu haben und fahren fort, »wollen wir sehen, ob Elias kommt und ihn vom Kreuz nimmt«. Es ist nicht einfach Zynismus, es ist auch hier ein letztes Mal eine schon irrsinnig werdende Hoffnung, die Dinge könnten sich noch zum Guten wenden. Das Missverständnis seiner letzten Worte durch die Umstehenden ruft diese Hoffnung am Abgrund hervor, wenn nicht bei den Missverstehenden, dann beim Leser. Jesus aber »schrie laut / und verschied«, wie Luther 1545 Mk 15,37 übersetzt.
Nicht damit endet das Evangelium. Hätte es damit enden wollen, es wäre ungeschrieben geblieben. Aber damit es endet, wie es endet, musste dies Menschliche bis zum Schluss vollendet werden. Nur der Gestorbene kann auferstehen, darin besiegelt der Tod seine Vollmacht – vorläufig. Wie hat sich ein Teil der frühen Christenheit dagegen gewehrt, diesen Tod des Göttlichen hinzunehmen – und wie wehren wir uns. Markus stellt uns kommentarlos vor das Unverständliche als ein Ereignis, das eingetreten ist, als fragte es weder nach Gott noch den Menschen. Es genügt, dass die Fakten sich aus einer inneren Folgerichtigkeit ins Dasein bringen, sich gleichsam von selbst erzählen. Wie kunstvoll Markus sie dennoch inszeniert, darüber hier nichts mehr.
Wir aber stehen vor der Aufgabe, das Unverständliche, das in der Auferstehung auch die Transzendenz Gottes zu denken nötigt, zu verstehen. Das Unverständliche verstehen heißt nicht, es dabei bewenden lassen in der Meinung, es sei eben unverständlich, es heißt noch weniger, siehe da, es ist doch verständlich. Es heißt vielmehr, beim Unverständlichen aufmerksam auszuharren.
Horst Folkers, geb. 1945, ist Bruder der Evangelischen Michaelsbruderschaft im Konvent Oberrhein. Er lebt und lehrt als Philosoph in Freiburg.
*1)
Das Markusevangelium, dessen Thema »Jesus Christus richtet das messianische Gottesreich auf« ist, lässt sich in fünf Teile, vielleicht in Analogie zu den fünf Büchern der Thora, gliedern.
Teil I: seiner Grundgestalt nach (1,1 – 4,34),
Teil II: indem es auf die leidende Welt ausgreift (4,35 – 8,26),
Teil III: indem Christus das Leiden auf sich nimmt (8,27 – 10,52),
Teil IV: durch Proklamation des Reiches im Tempel in Jerusalem (11,1 – 13,37),
Teil V: im Vollzug der Leidensmessianität durch Christus (14,1 – 16,8).
Eine Gliederung des Evangeliums in fünf ebenso abgegrenzte Teile schlägt auch Lührmann vor, Dieter Lührmann, Das Markusevangelium, Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) 1987, vgl. insbesondere S. 2323 – 37. Da Lührmann Mk 1,1 – 15 als eine Art Prolog von 1,16 – 4,34 abtrennt, kommt er allerdings auf sechs Teile. Die Gliede-rungskunst des Markus verkannte die formgeschichtliche Forschung. So kommt Bultmann zu dem Fehlurteil: »Mk ist eben noch nicht in dem Maße Herr über den Stoff geworden, daß er eine Gliederung wagen könnte«, Rudolf Bultmann, Die Geschichte der synoptischen Tradition (1921), mit einem Nachwort von Gerd Theißen (1995), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 101995, S. 37524.25.
*2)
vgl. Emanuel Tov, Der Text der hebräischen Bibel, Handbuch der Textkritik (1989), aus dem Englischen übersetzt von Heinz-Josef Fabry aufgrund der Ausgabe von 1992, Stutt-gart Berlin Köln: Kohlhammer 1997, S. 11421 – 32.
*3)
Diese Übersetzungsvariante begründet Stuhlmacher, »da kaqw;“ gevgraptai im Neuen Testament nirgends einen neuen Satz einleitet, sondern stets begründend gebraucht wird, ist auch zwischen 1,1 und 1,2 kein Punkt zu setzen. Vielmehr ist zu übersetzen: ›Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, wie (es) geschrieben ist bei dem Propheten Jesaja …‹«, Peter Stuhlmacher, Biblische Theologie des Neuen Testaments, Bd. 2, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1999, S. 12026 – 30.
*4)
Hengel weist auf den historischen Grund des Nichtverstehens der Jünger hin, denn »für das zeitgenössische Judentum, wie für die antike Welt überhaupt« war die Tatsa-che, dass der Messias und Gottessohn den Weg ans Kreuz ging, »ein unerhörter, über-aus anstößiger Gedanke, den die Jünger, weil er der traditionellen messianischen Heilserwartung widersprach, nicht verstehen konnten«. Martin Hengel, Probleme des Markusevangeliums, in: Peter Stuhlmacher (Hg.), Das Evangelium und die Evangelien, Tübingen: Mohr 1983, S. 220 – 265, hier S. 2388 – 11.
Die Neu(er)findung des Namens Gottes
Wo ist Gott denn hingekommen?
von Gérard Siegwalt
Gott neu denken. Das war die ursprüngliche Formulierung des Themas.1 Das Thema ist die heutige Art und Weise, in der sich die Gottesfrage stellt. Ich rede diesbezüglich von der neuen Entdeckung, ja von der Neu-findung und gar von der Neu-erfindung Gottes.
Das Thema erfordert von uns die Einsicht in die Notwendigkeit, einen Weg zu beschreiten, und zwar den von der Kirche, vom Glauben hin zur Welt, in ihre Wirklichkeit der Erschütterung. Also: den Wanderstab nehmen, nicht um unseren säkularen Mitmenschen Christus oder Gott nahe zu bringen – dies Unterfangen ist, als absichtliches, also als interessiertes, heute meist ganz kontraproduktiv –, sondern um eine Frage mit ihnen zu teilen, und zwar ohne irgendeinen proselytischen Hintergedanken, die Frage nämlich: Wo ist Gott, außerhalb unserer Gottesdienste und kirchlichen Veranstaltungen, außerhalb auch unserer persönlichen Frömmigkeit, wo er ja auch nicht immer so eindeutig spürbar oder erkennbar ist, wo ist Gott eigentlich hingekommen? Die Frage ist diese: Gott – was ist das für Sie, und wo ist er? Es geht dabei nicht um fertige Antworten, die als solche sehr problematisch erscheinen würden, sondern um Hinweise, die vielleicht ein Fenster, eine Tür öffnen und einen Raum offenlegen, in den hineinzuwagen dann die uns sich stellende – gewiss lebensumwerfende – Entscheidung wäre. Die Entscheidung, gemeinsam den Wanderstab zu nehmen, um Gott zu entdecken, zu finden, ich sage gleich auch mal: neu zu erfinden.
In drei Schritten möchte ich dieses Thema jetzt angehen.
I. Es geht zunächst darum, genauer den Ausgangspunkt des neuen Fragens nach Gott zu klären. Er lässt sich folgendermaßen – in zweierlei Hinsicht – umschreiben. Einmal gilt für uns Christen, oder allgemeiner gesagt: für die an Gott Glaubenden (das gilt ebenso für Juden als auch Muslime), dass es eine Weltwirklichkeit Gottes gibt, reden wir doch von Gott als dem Schöpfer – dem kontinuierlichen Schöpfer und somit Erlöser von Himmel und Erde, also von allem, das es gibt. Wir sprechen von Gottes Providenz (providentia), d. h. seiner Fürsorge für die Schöpfung. Aber wir müssen uns selber gestehen: Diese Glaubensaussage ist für uns selber, ganz konkret gesehen, oft wenig »greifbar«, wenig ein-sichtig, wenig uns selber tragend: Unsere eigene Weltwirklichkeit ist weithin durch ihre Autonomie, ihre Selbstständigkeit von Gott, nicht durch ihre Theonomie, ihre Verbundenheit mit Gott, gekennzeichnet. Aber nicht nur das: Diese Glaubensaussage ist für die immer größer werdende und oft schon längst überwiegende Zahl unserer Zeitgenossen und dann vor allem für das die Welt beherrschende – produktivistische und konsumeristische – Wirtschaftssystem ganz sinnlos geworden, beruht dieses doch auf der Ideologie der sich absolut verstehenden Autonomie und somit der Machbarkeit dieser Welt. Die genannte Glaubensaussage hat angesichts dieser Ideologie keinerlei Glaubwürdigkeit.
Dann ist klar: Es geht nicht an, einfach die Weltwirklichkeit Gottes weiter zu proklamieren, als gäbe es diesen Mangel an Glaubwürdigkeit nicht. Der prophetische Widerspruch hat nur dann Vollmacht, wenn er ein-sichtig, in seiner Aussage nachvollziehbar und somit eben glaubwürdig erscheint. Die Voraussetzungen dazu sind aber nicht gegeben, solange der Widerspruch sich damit begnügt, einfach nur traditionelles Glaubensgut weiterzugeben, ohne dass sich dasselbe erschüttern ließe durch neue Gegebenheiten der Welterfahrung. Der wahre prophetische Widerspruch beruht immer auf einer Wahrnehmung der jeweils neuen Wirklichkeit, also der unten – irdisch, existenziell – erlebten Wirklichkeit, und auf deren Hineinstellen in das Licht von oben, also auf deren Hinordnung, auf deren In-Bezug-Stellung auf eben den als lebendigen Schöpfer und Erlöser, also auf den in seiner Weltwirklichkeit geglaubten Gott. Dazu ist es aber nötig, diese Weltwirklichkeit, wie wir sie erleben, wahrzunehmen, d.h., sie durchzuschreiten, sie durchzuleiden, denn nur so, nicht anders, öffnet sie sich für die Gotteswirklichkeit, also für die Weltwirklichkeit des geglaubten Gottes. Es geht also darum (so drückt Paul Tillich die Sache aus), die Korrelation zwischen der jeweiligen menschlichen Situation und der biblischen Glaubensbotschaft zu erkennen. Es geht um die Korrelation, die Beziehung – und zwar die gegenseitige Beziehung, genauer: die gegenseitig kritische Beziehung – zwischen dem geglaubten Gott und der erfahrenen Weltwirklichkeit. Dazu aber ist nötig, dass wir nicht allein oben, nicht allein bei Gott ansetzen, sondern auch unten, bei unserer jeweils gegebenen empirischen Wirklichkeit.
Es gibt nur prophetische Rede, sozusagen von oben nach unten, von Gott zur Welt, wenn es das Durchschreiten des unten gibt, also nur so, dass wir die sich stellenden Fragen unten erkennen, benennen – und zwar ein-sichtig, nachvollziehbar, glaubwürdig, verantwortlich benennen – und sie so, also ganz induktiv, ganz von unten, von der erfahrenen und erfahrbaren Menschen- und Weltwirklicheit ausgehend, nach oben hin öffnen, sie auf den geglaubten Gott und auf seine geglaubte Weltwirklichkeit beziehen.
Mit diesen zwei Hinweisen, die unseren Ausgangspunkt kennzeichnen, erkennen wir die uns gewiesene Herangehensweise zu der gestellten Frage nach Gott und seiner Weltwirklichkeit. Was gibt in unserer erfahrenen Weltwirklichkeit Anlass zu dieser Frage? Also: Welches ist der Kontext zu dieser Frage, der dieselbe nahelegt, ja ihr ihre Glaubwürdigkeit als Frage gibt?
II. Damit sind wir, nach der Klärung der Vorgehensweise (der Mehode), bei der Frage angelangt, warum sich die Gottesfrage, als Frage nach der Weltwirklichkeit Gottes, heute neu stellt, jedenfalls stellen könnte, die dann den Weg ebnet, um auf Zeitgenossen zuzugehen mit der Frage: Gott, was ist das für Sie, und wo ist er?
Ich will mich hier begnügen mit wesentlichen Hinweisen.
Die ökologische und die damit verbundene klimatische Katastrophe. Sie betrifft die Beziehung der Menschheit zur Natur, also die Naturphilosophie und dann die Naturethik. Sie ruft einen mehr und mehr spürbaren, von einer immer breiteren Öffentlichkeit wahrnehmbaren und wahrgenommenen Ruck rund um die Welt hervor. Wir spüren als Menschheit: Da bewegt sich etwas, das uns als Gesamtmenschheit betrifft, etwas, das einer Lawine oder einem Tsunami vergleichbar ist, mit einer nicht nur lokalen, sondern einer globalen Auswirkung, einer Auswirkung, die nicht nur andere betrifft, sondern auch über uns selber als Damoklesschwert schwebt.
Aber dies darf uns nun nicht zu einem Kurzschluss führen. Der Kurzschluss für die an Gott Glaubenden wäre zu sagen: So, jetzt sind wir dran, mit dem Ruf zu Gott zurückzukehren. Ein solcher Ruf ist natürlich immer begründet, aber auch als solcher kann er völlig abwegig, völlig verfehlt sein. Denn ein solcher so direkt von oben, vom Himmel kommender Ruf ist ohne irdische Grundierung, also bodenlos, nicht erdhaft verankert, nicht »inkarniert«. Er schießt deshalb am Ziel vorbei, weil er an unserer erfahrbaren Weltwirklichkleit vorbeischießt, sie umgeht, sie überhaupt nicht erkennt.
Denn um was geht es denn bei der genannten Umwelt- und Klimakatastrophe? Es geht um ein von uns Menschen, von unserer dominierenden Zivilisation (mit ihrem schon erwähnten Wirtschaftssystem der Machbarkeit und der damit verbundenen Vergötzung des Geldes) selbst verschuldetes Gericht, nach dem Motto: »Was der Mensch sät, das erntet er.« Seit der griechischen Antike bezeichnet man dies als immanentes Gericht. Nicht Gott oder die Götter bewirken es, sondern das Gesetz von Ursache und Wirkung. Nicht der Glaube ist das hier zuerst Geforderte, sondern die Vernunft: Umkehr zur Vernunft, zur Weisheit! Überspringt der Ruf zur Buße, also zum Glauben, den Ruf zur Vernunft, dann hängt er sozusagen in der Luft, er geht am Greifbaren, am Erdhaften vorbei, d.h., er bleibt unglaubwürdig. Ich erinnere an Christoph Blumhardt. Was sagte er dem frommen Bauern, der darüber klagte, dass trotz seiner treuen Bitten zu Gott sein Acker von Jahr zu Jahr weniger Erträge brächte: »Ehe du weiterbetest, bring dem Acker doch einen Wagen Mist!« Umkehr (Hinkehr) zur Vernunft!
Und da kommt jetzt der Glaube, also ganz elementar die Gottesfurcht, ins Spiel. Wir erinnern uns an das Wort aus dem Buch der Sprüche: »Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis« (oder der Weisheit). Die Gottesfurcht hängt mit der Einsicht unserer letzten Abhängigkeit von allem, was ist, zusammen, und zuletzt von dem, der dies alles trägt und leitet, also dem Ursprung und Ziel von allem. Der Glaube, die Gottesfurcht! Denn wer gibt den Mut und die Kraft zu solchem Umdenken angesichts dessen, was da für einen jeden von uns und für ein jedes unserer Völker, ja für unsere gesamte Zivilisation auf dem Spiel steht? Ja, wer gibt die Fähigkeit zu solchem Umdenken, das ja alles betrifft, d.h., das darin besteht, dass wir uns von unserem Teildenken trennen, dass wir es als Teildenken bloßstellen, dass wir uns dem All stellen, uns also anderen Teilaspekten der Wirklichkeit öffnen, um sie einzubeziehen und so recht eigentlich »denken« zu lernen? Denn das Denken besteht, im Unterschied zum Wissen und Machen, in der Aufgabe, Wissen und Machen hinzuordnen auf das All, auf die Gesamtwirklichkeit. Das Denken ist das Erkennen der Beziehungen zwischen den Teilen in ihrer Öffnung hin auf die Gesamtwirklichkeit, innerhalb derer die Teile ihren Teilplatz haben.
Diese Öffnung auf das All, auf die Gesamtwirklichkeit, stellt dann vor die grundlegende Frage: Dieses All, genügt sich dassel.be, ist es in sich abgeschlossen, oder trägt es ein Geheimnis in sich, das es als zutiefst alle menschliche Verstehensfähigkeit übersteigend erscheinen lässt, eben das Geheimnis eines Ursprungs und eines Ziels, wovon wir nur zu stammeln in der Lage sind und dies auch tun, indem wir von Gott sprechen? Gott ist der stammelnde Name, den wir diesem alles tragenden Geheimnis geben. Umkehr zur Vernunft ist dann also auch Umkehr zu Gott, zur Neu(er)findung Gottes und so Umkehr zur Gottesfurcht, zur uns schüttelnden, in unseren Gewohnheiten und Sicherheiten erschütternden und durch dieses Erschüttertwerden uns neu zum Staunen befähigenden Ehrfurcht Gottes: der Weg von der Vernunft und der so bezeichneten Weisheit hin zum Glauben an Gott, zur Gottesfurcht und dann umgekehrt auch der Weg von der Gottesfurcht hin zur Weisheit, hin zur Vernunft.
Weg von unten nach oben, Weg von oben nach unten. Die ökologische und die klimatische Katastrophe als immanentes Gericht und so als unten aufbrechender prophetischer Ruf zur Hinkehr zur Vernunft und Gottesfurcht und als öffnend auf den von oben hereinbrechenden prophetischen Ruf zur Hinkehr zum Glauben, zur Gottesfurcht.
Die soziale Katastrophe. Sie betrifft die Beziehung der Menschen untereinander. Es geht dabei um die Gerechtigkeit zwischen Menschen, also zuletzt um Anthropologie und dann auch politische und soziale Ethik. Wir wissen, angesichts z.B. der wirtschaftlichen Ungerechtigkeit zwischen Völkern und innerhalb der Völker zwischen sozialen Schichten, nicht nur um den akuten, das soziale Gleichgewicht unmittelbar gefährdenden Charakter dieser Katastrophe, also um die Gefährdung des Friedens, die darin begründet ist, sondern auch – ganz elementar – um die Gefährdung des Menschseins, also der zwischenmenschlichen Solidarität, um den Abgrund der Barbarei, der sich da ganz real öffnet.
Die persönlichen Katastrophen. Sie betreffen die Beziehung des Menschen zu sich selbst. Dabei geht es einmal um Schicksalsschläge (Unglück, das einen trifft) und darin um das Erkennen eines Sinns (das erfordert meist einen langen Weg, den Weg einer Therapie psychologischer und gewiss auch geistlicher Art): Zutiefst bricht da die Theodizee-Frage (die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes angesichts solcher Geschehnisse) auf, also die – metaphysische – Gottesfrage, dann auch die ethische Frage nach Ausgleich aufgrund der zwischenmenschlichen Solidarität und so nach Gerechtigkeit (dies gilt auch auf überpersönlicher Ebene, also zwischen Völkern und Klassen). Dann geht es dabei um Schuld, um ein Tun, das uns schuldig macht, aber auch um Verstrickung, wo wir einfach gefangen sind in selbstgemachter Sklaverei, wobei dann die Frage nach Vergebung, nach Befreiung, nach Versöhnung, nach Rettung und Frieden (persönlich und auch überpersönlich) aufbricht.
Alle diese drei Beispiele sind Einfalltore für die Gottesfrage, also für die Frage: »Gott, was ist das für Sie, und wo ist er?« Und diese Einfalltore müssen durchschritten, durchgearbeitet (perlaboriert) werden, um die Gottesfrage als sich heute neu stellend darin freizulegen. Es gilt also, die Gottesfrage da aufzugreifen, wo sie sich uns heute stellt, unten, im Empirischen, in dem, was uns existenziell betrifft.
III. Genau hier werden wir nun einen Schritt weitergeführt. Die von uns erfahrene Weltwirklichkeit (siehe die drei Beispiele), sozusagen der Schock der Wirklichkeit, von dem wir ausgehen und der uns neu dazu führt, nach Gott zu fragen, lässt uns, in unserer neu entstehenden Gottesfurcht, unsere damit gegebene Bedürftigkeit erkennen. Wir sind gleichsam an einen Anfang zurückgeworfen, einen Anfang, der eine Verheißung enthält, die wir spüren, aber mit welcher auch eine Hilflosigkeit verbunden ist. Jesus spricht diesbezüglich von geistlicher Armut, wenn er in der ersten Seligpreisung sagt: »Selig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Himmelreich.« Geistliche Armut, geistliche Bedürftigkeit, Erkenntnis, dass wir es nicht von uns aus schaffen.
Gibt es da nicht eine Analogie zu der Situation, wie sie in Genesis 4 geschildert wird? Da wird zunächst der Totschlag seines Bruders Abel durch Kain erzählt, dann wird die erste Zivilisation geschildert, wie sie durch Kains Nachkommen entsteht (die Stadt, die handwerklichen Berufe, die Konflikte, die Kriegspotenzial in sich haben). Und dann ist von der Generationenfolge, wie sie bei Adam anknüpft, die Rede (»Adam erkannte abermals sein Weib, und sie gebar einen Sohn, den nannte sie Seth …«), mit diesem zusätzlichen Hinweis: »Zu der Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen« (Gen 4, 26). In einer gottlosen Zeit, unter der Schicksalsmacht des immanenten Gerichts stehend, die Entdeckung, die Erfindung des Namens Gottes, des Anrufes an Gott! Für uns heute: die Zeit – der Kairos – einer neuen Entdeckung, einer neuen (Er-)findung Gottes, vielmehr des anzurufenden oder anrufbaren Namens Gottes.
In dieser Erkenntnis unserer Bedürftigkeit geht es nun um eine Rückbesinnung, einen Rückgriff, auf die Bezeugungen der Gottesfindung in der Vergangenheit, d.h. der Gottesoffenbarung. Es geht nicht darum, »das Rad neu zu erfinden«. Das Rad ist erfunden, so sehr wir auch an dem Punkt stehen, wo wir es für uns neu entdecken.
Das heißt: Der Schock der Wirklichkeit führt uns zur Geschichte, zum Gedenken an die Geschichte. Wir kennen die Aussage: Ohne Gedächtnis keine Zukunft (siehe etwa: Auschwitz!). Bei diesem Rückgriff auf die Vergangenheit sind die Religionen gefragt: Was holen sie aus ihrem »Schatz« hervor, das für die heutige Zeit, für die sich neu stellende Gottesfrage, von Belang – zutreffend – ist. Nicht gleich als Antwort auf die Gottesfrage, aber als Geist, als Inspiration für diese zu findende Antwort. Die Antworten der Vergangenheit müssen nämlich neu entdeckt werden, es genügt nicht, sie zu wiederholen. Das ist die Aufgabe der Deutung, der Interpretation, also der Hermeneutik. Die Deutung, die Übertragung des Vergangenen in das Heutige erfordert das Bedenken ebenso des Vergangenen (also des in den jeweiligen Heiligen Schriften Bezeugten) wie auch des Heutigen (der Herausforderungen angesichts der erwähnten Katastrophen). Es geht also bei der Interpretation nicht allein um Wiederentdeckung (dann bleibt man an der Vergangenheit haften: das ist die Haltung des Fundamentalismus), sondern es geht, gewiss dank des Rückbezugs auf diese Vergangenheit, also dank der Wiederentdeckung, um die Aktualisierung und Vergegenwärtigung des so Wiederentdeckten. Und diese Aktualisierung erfordert, über die Korrelation zwischen gestern und heute, zwischen Geschichtserinnerung (Heilige Schriften) und ihren aktuellen Bezug hinaus, zugleich die Korrelation zwischen der heutigen Gottesfrage und der heutigen Wirklichkeit, also zwischen Letzterer mit ihren Herausforderungen und der durch dieselbe ausgelösten neuen Gottesfrage.
Das alles zusammengenommen übersteigt die Fähigkeiten eines Einzelnen, erfordert vielmehr Zusammenarbeit, beständigen Dialog zwischen den Schriftgelehrten, den Theologen verstanden als Hermeneuten einerseits und denjenigen, die in den Herausforderungen zu Fragenden werden anderseits. Es geht da um apologetische, d.h. wörtlich um antwortende Theologie (siehe 1 Petr 3,15). Nicht Selbstverteidigung, sondern Verantwortung, d.h. verantwortliche Responsivität, antworten in Verantwortung! Antworten auf die neu gestellte Gottesfrage in Berücksichtigung dessen, wovon diese Frage ausgelöst wird, um mit Bezug darauf die Botschaft der Vergangenheit zu verantworten, also verantwortlich hineinzutragen in einen völlig neuen Kontext. Das heißt dann: Die heute Fragenden gehören mit hinein in die theologische Aufgabe! Wir werden derselben nur gerecht, wenn wir nicht an unseren fragenden Mitmenschen vorbeireden oder wenn wir ihnen nicht helfen, ihre neue Gottesfrage zu erkennen, sondern nur einbezüglich dieser Aufgabe, also jener, auf unsere Zeitgenossen zuzugehen mit der eingangs gestellten Frage: Wer ist Gott für Sie, und wo ist er ?
Ich kann hier nur kurz auf die interreligiöse Dimension dieser Aufgaben hinweisen. Alle Religionen sind betroffen von der besagten notwendigen Rückbesinnung auf ihren geistlichen Glaubensschatz angesichts der heute vor uns stehenden Herausforderungen. Eine jede hat da ihren Beitrag zu liefern, dazu also, ihre Glaubwürdigkeit für heute unter Beweis zu stellen. Und dies dann auch im interreligiösen und d. h. im gegenseitig kritischen Dialog. Auch zwischen den Religionen: antwortender-verantwortlicher Dialog! Zum Besten des Allgemeinwohls, des Wohls der gesamten Menschheit als durch die Herausforderungen Befragten und darin Fragenden.
Schluss
Ich erinnere an den Ausgangspunkt. Es war die Frage: Wo ist Gott denn hingekommen? Und damit in der Weitergabe der Frage an andere: Gott, was ist das für Sie, und wo ist er?
Dann erinnere ich an die drei Teile des danach Ausgeführten.
I. Prophetische Rede von Gott gibt es nur angesichts des Glaubwürdigkeitsverlustes der traditionellen Glaubensaussagen in unserer dominierenden Zivilisation, um den Preis der gegenseitig kritischen Beziehung (Korrelation) zwischen der unten induktiv erfahrenen Weltwirklichkeit mit ihren da aufbrechenden nach oben, auf Gott hin sich öffnenden Fragen und der aufgrund der von oben gegebenen Gottesoffenbarung geglaubten Weltwirklichkeit Gottes.
II. Deshalb geht es um die Klärung der in der heute erfahrenen Weltwirklichkeit aufbrechenden Gottesfrage. Ich nannte drei Beispiele, die als Schockerlebnisse ein neues Fragen nach Gott – und wie, in welcher Hinsicht – aufbrechen lassen.
III. Ausgelöst durch diese Schockerlebnisse kommt es zu einer neuen Rückbesinnung auf die in der Geschichte vorgegebenen religiösen Traditionen und ihre Gottesbezeugungen, mit dem Ziel zu deren Freilegung – Wiederentdeckung einerseits und ihrer Aktualisierung für heute, im neuen Fragekontext, anderseits. Wir erkannten, dass diese theologische Aufgabe nur gelöst werden kann durch den kritischen (d.h. unterscheidenden, und zwar gegenseitig unterscheidenden) Dialog aller Betroffenen: zwischen einerseits den theologischen Hermeneuten und anderseits den den heutigen Kontext mit seinen Herausforderungen und der darin sich stellenden Gottesfrage Benennenden: Es sind das die, aus welchem besonderen Erfahrungsbereich sie auch kommen, die sich als existenziell von der neuen Gottesfrage betroffen seiend erkennen; sie stehen für viele andere, ja potenziell für die Gesamtmenschheit.
Es geht jetzt ganz einfach um die Erkenntnis, dass Gott heute neu gefunden, und d.h., dann auch neu erfunden werden muss. Neu-Entdeckung Gottes als Neu-Findung, ja als Neu-Erfindung Gottes. Das ist jetzt noch kurz auszuführen in folgenden Thesen.
Glaube an Gott ist nie nur übernommener, tradierter Glaube. Wir denken an das Goethe-Wort: »Was du ererbt hast von deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen.« Der Glaube ist immer schöpferisch, kreativ. Er ist es als übernommener Glaube: Nur wenn dieser kreativ wird, ist er lebendig: Er erweist seine Lebendigkeit in seiner Kreativität. Und er ist auch schöpferisch als neu gefundener Glaube. Die Kreativität besteht in beiden Fällen in zweierlei: Einmal in der kreativen Erhellung der Gegenwart und ihrem Gottesbezug. Dann in der kreativen Deutung, also Aktualisierung der vorgegebenen Heiligen Schriften.
Schon der biblische, also der in den Heiligen Schriften Alten und Neuen Testaments (und wohl auch des Korans) bezeugte Glau.be war immer kreativ. Er war es als sich findender (auch in der Bibel gibt es schon den Weg von unten nach oben), und er war es als übernommener/tradierter. Das ganze Alte (oder: Erste) Testament bezeugt das immer neue und das immer tiefere Finden Gottes von unten her, und es bezeugt die Weitergabe (Tradierung) dieses Gottesglaubens – als vorgegeben – von oben her. Und zugleich bezeugt es die Spannung, manchmal die konfliktuelle Spannung, zwischen beiden. Denken wir an die prophetische Verkündigung mit ihrer Kritik an der festgenagelten, versteiften, sich einengend und gleichsam ideologisch verstehenden Glaubensüberlieferung. Im Neuen Testament, denken wir an die scharfe Kritik Jesu (und dann auch vor allem des Paulus) an einer Glaubenstradition, die mehr Menschentradition war und als solche die lebendige Glaubenstradition pervertiert (fehlgeleitet) hat. Schon für die Bibel in sich gilt der Satz: »Die Kritik an der Religion ist notwendig für ihre Wahrheit.« Diese Kritik geschieht nicht allein von außen, sondern zutiefst von innen her, von einem lebendigen, kreativen Verständnis her.
Kreativer Glaube ist prophetischer Glaube. Kreativität und Prophetie gehören zusammen. Wir wissen um die Bedeutung der Propheten im Alten Testament: Sie aktualisieren je und je, in den immer neuen Kontexten, die dem Volk Gottes zugrunde liegende Offenbarung Gottes, wie sie im Shema Israel (Dtn 6,4) bekenntnismäßig zusammengefasst ist. Und wir kennen die Aussage des Paulus von dem den Glauben begründenden Grund (dessen Eckstein Jesus Christus ist) der Apostel und Propheten (Eph 2,20): Mit den Aposteln sind die von Christus eingesetzten und vom Heiligen Geist bevollmächtigten Träger der Christusbotschaft bezeichnet. Ihnen folgen die Propheten: Das sind nicht die alttestamentlichen Propheten, sondern die neutestamentlichen (siehe 1 Kor 12,28), deren Charisma und somit auch Mandat (Aufgabe) es ist, dieses Evangelium von Jesus als dem Christus je und je zu aktualisieren (wie denn die Apostel das schon immer selbst tun). Die apostolische Verkündigung des Evangeliums ist, wenn sie vollmächig ist, prophetische Verkündigung: Sie deutet die biblische Botschaft für die jeweilige Zeit und somit kontextuell. Als solche ist sie kreativ. Ausdrücklich auf das in 1 Kor 12–14 über die Prophetie Ausgeführte Bezug nehmend gilt, dass diese aktualisierende Deutung der biblischen Verkündigung einmal der immer neuen Erhellung des jeweiligen Kontextes bedarf, und dann, dass sie hierzu die kritische Kontrolle der Gemeinde, ja der weiteren gesellschaftlichen – besonders auch kulturellen – Umwelt braucht. Ich verweise bezüglich des kreativen Charakters der Deutung der vorgegebenen biblischen Botschaft auf die Abschiedsreden Jesu im Johannesevangelium. Jesus verheißt da den Parakleten, den Geist, der gewiss die Verkündigung der Jünger so leiten wird, dass sie Christusverkündigung ist, der aber diese Christusverkündigung offen hält für ihre unergründbare Fülle (Joh 16,13).
Als Letztes möchte ich, im Anklang an das anfangs zum Wanderstab Gesagte, den es zu nehmen gilt hin zur säkularen Welt, mit dem Satz aus der Regel der Michaelsbruderschaft schließen: »Der Bruder weiß, dass die wahren Entscheidungen der kämpfenden Kirche in dem geistlichen Kampf ihrer Glieder fallen, und stellt sich mit seinem ganzen Leben unter diese Verantwortung. Er bittet um den Geist der Unterscheidung.« Die Urkunde spricht, weil unabdingbare Voraussetzung für das an die Welt zu ergehen.de Wort der Entscheidung, von dem den Bruder verpflichtenden »priesterlichen Dienst des Gebets«. Anders gesagt : Prophetie gibt es nicht ohne den Quellort des Kämmerleins, nicht ohne gelebte Kirche, wie dies ja unsere Berufung als Michaelsgemeinschaft ist.
Prof. em. Dr. Gérard Siegwalt, geb. 1932, ist Bruder der Evangelischen Michaelsbruderschaft im Konvent Oberrhein und lehrte als Professor für Dogmatik an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Univer.sität Straßburg.