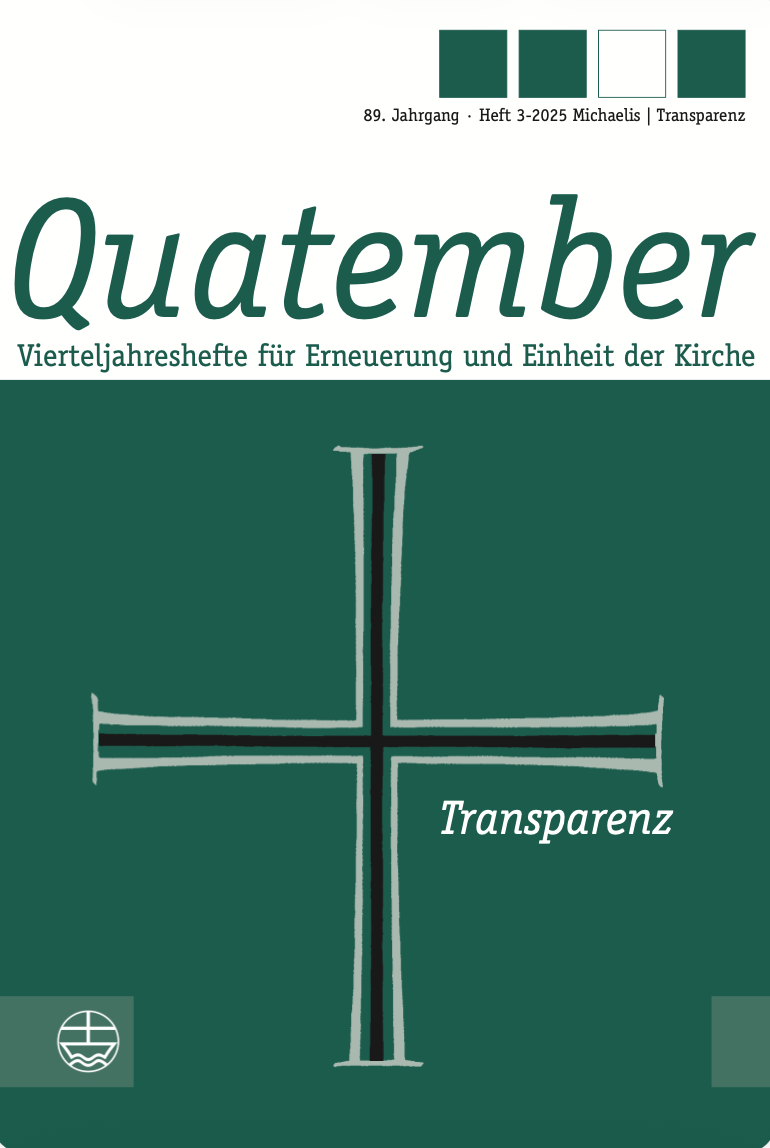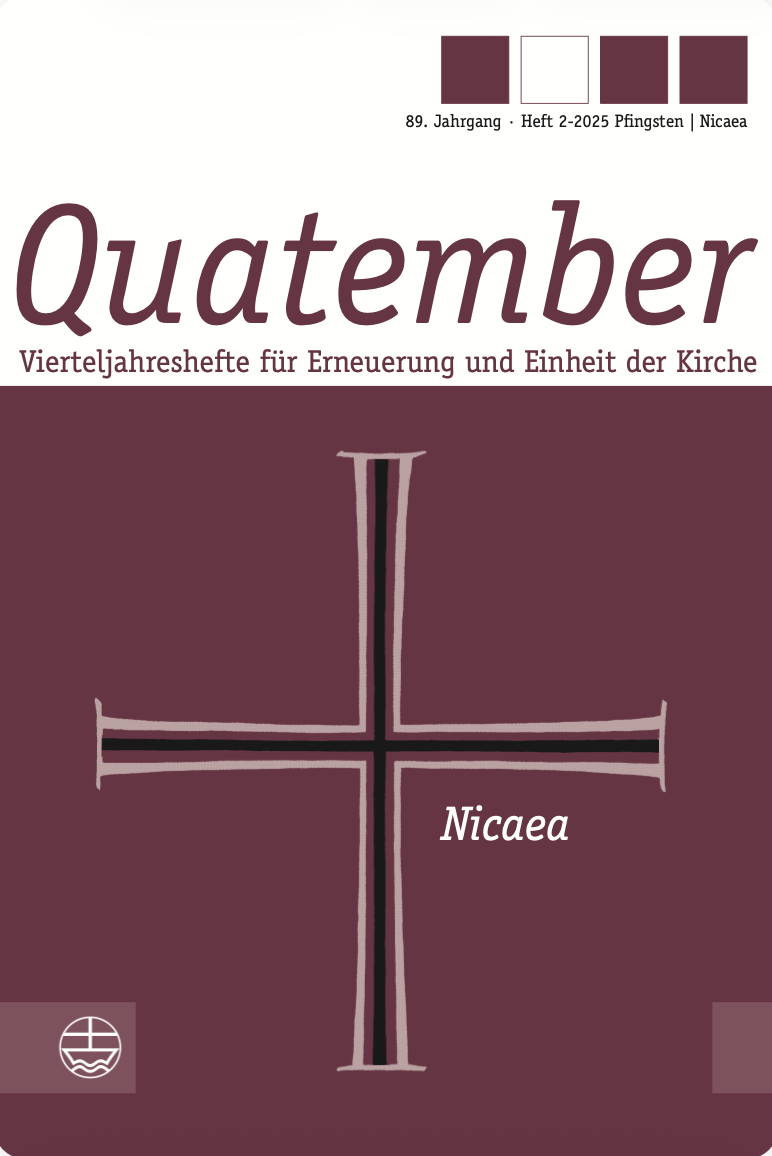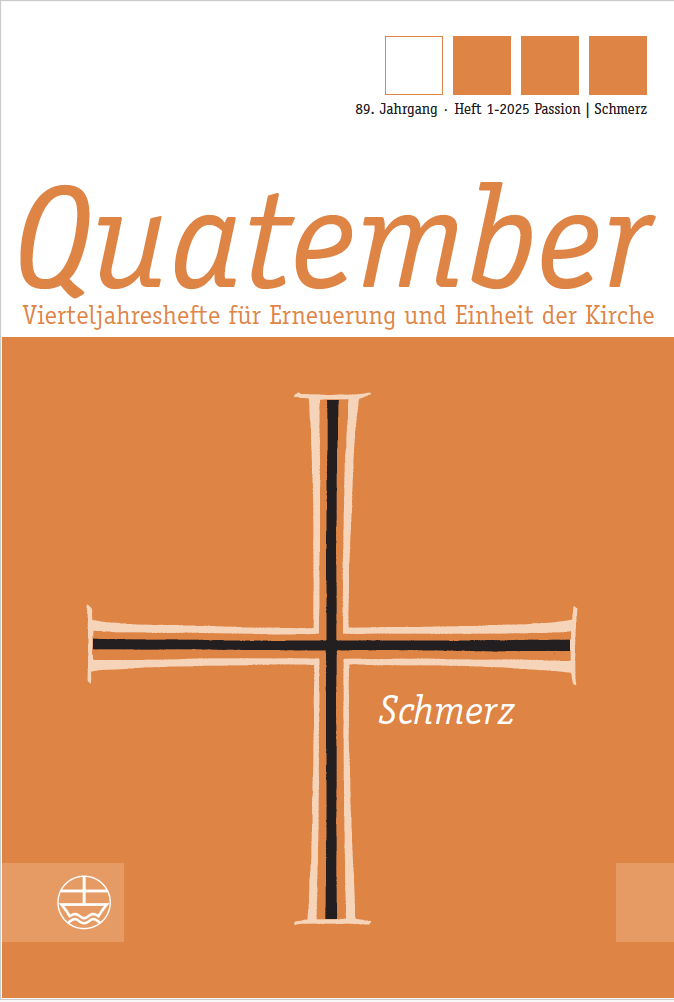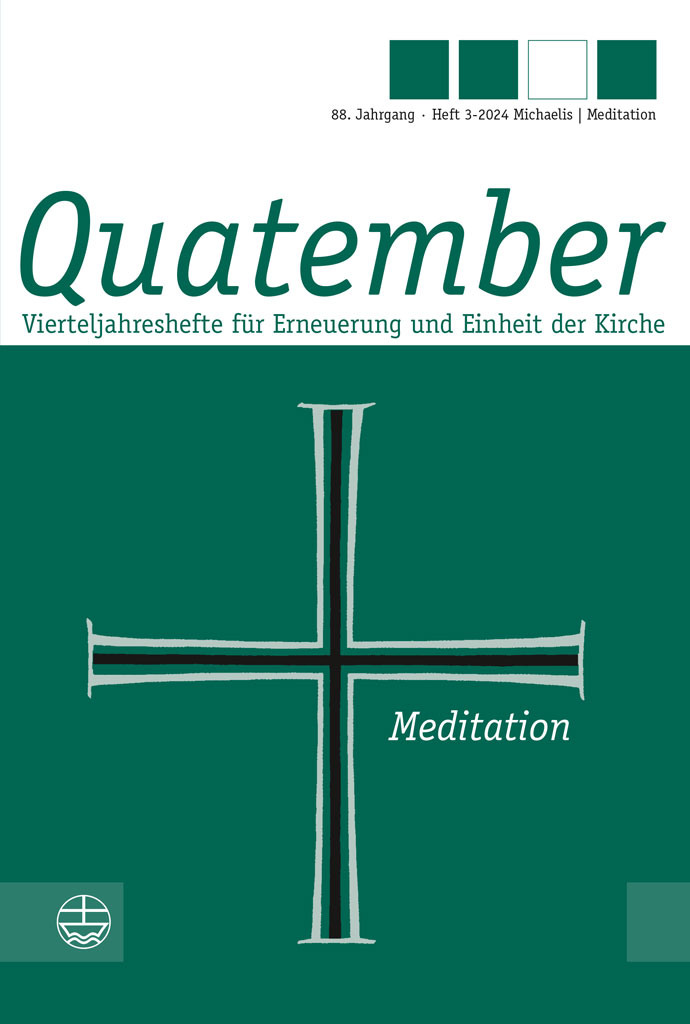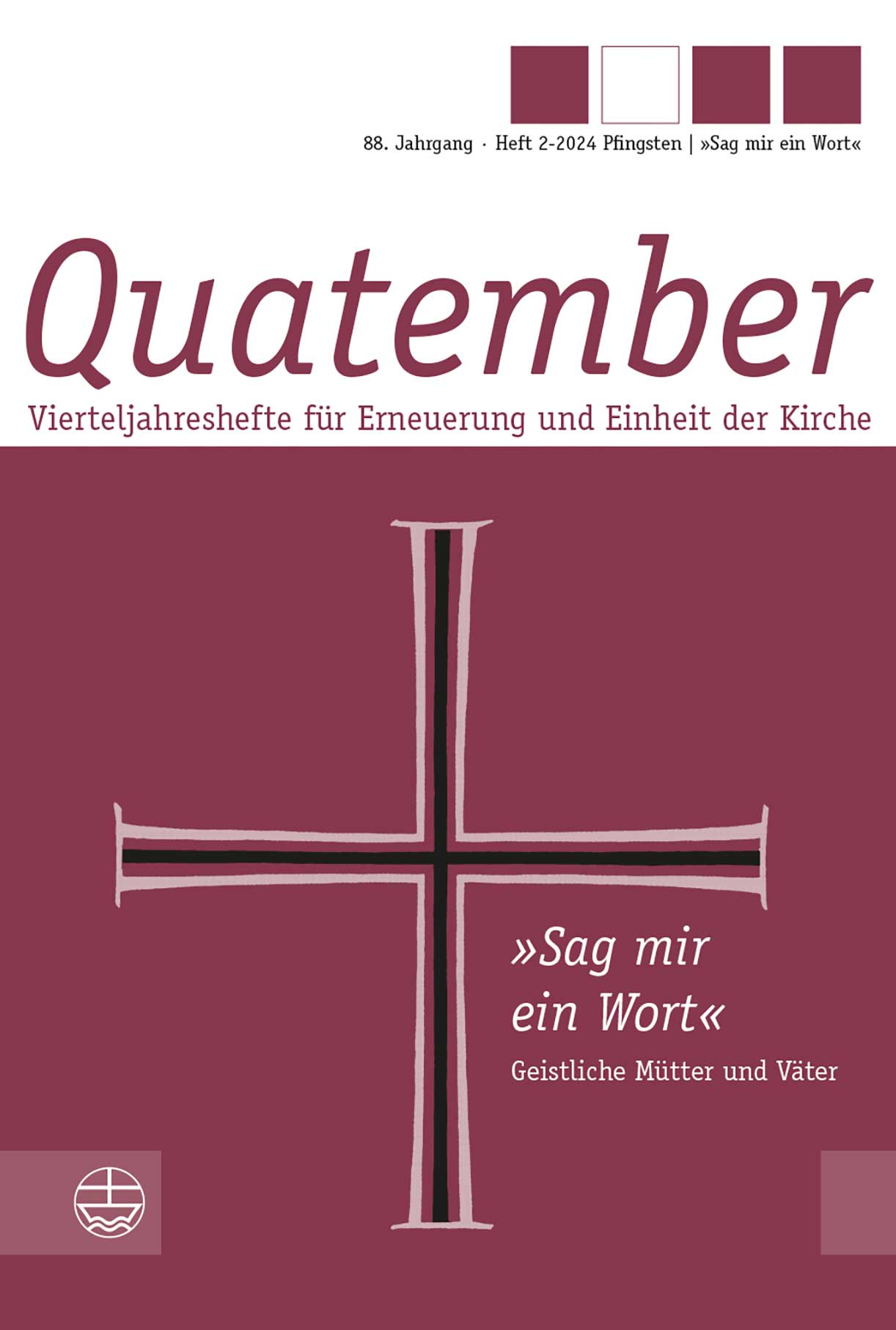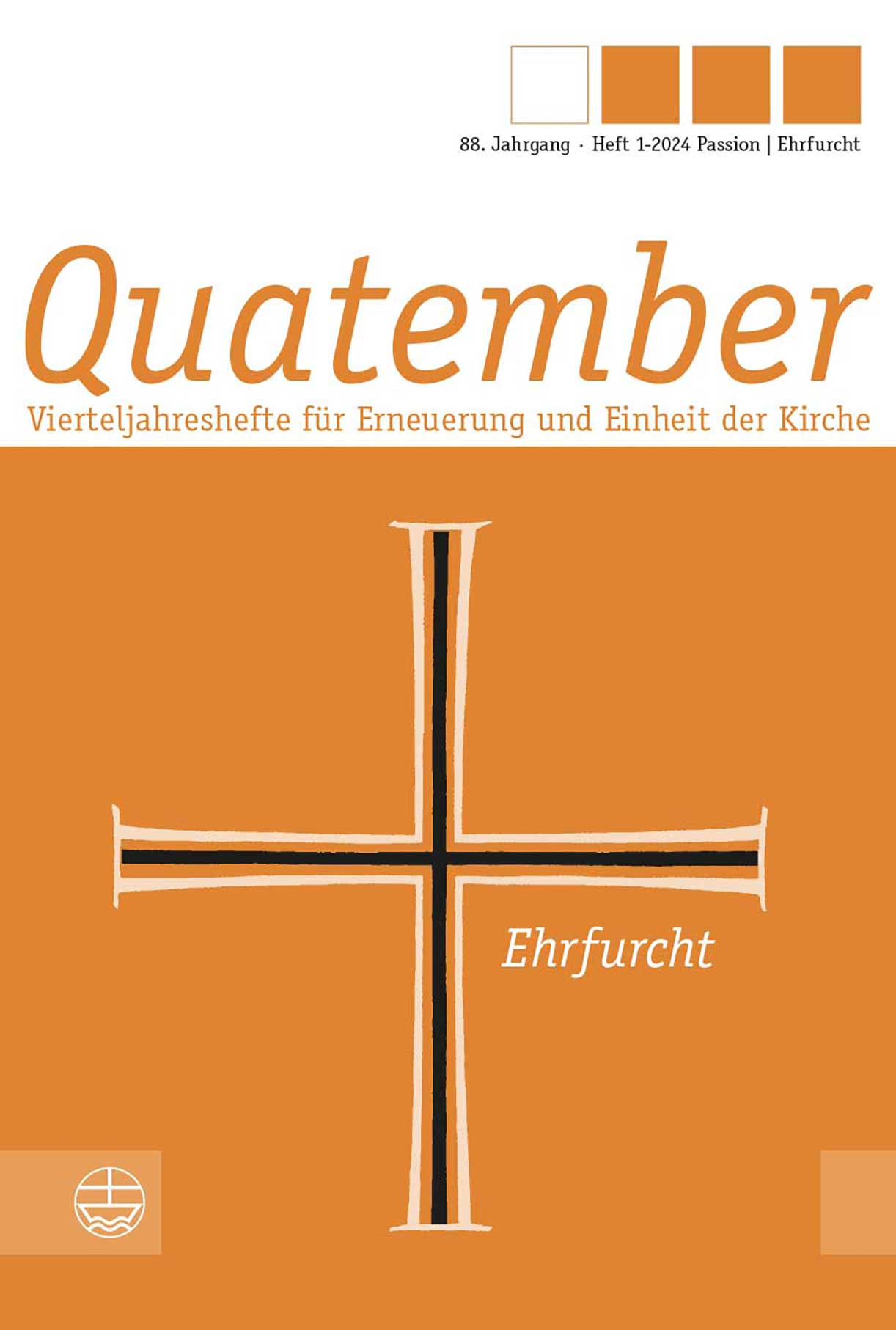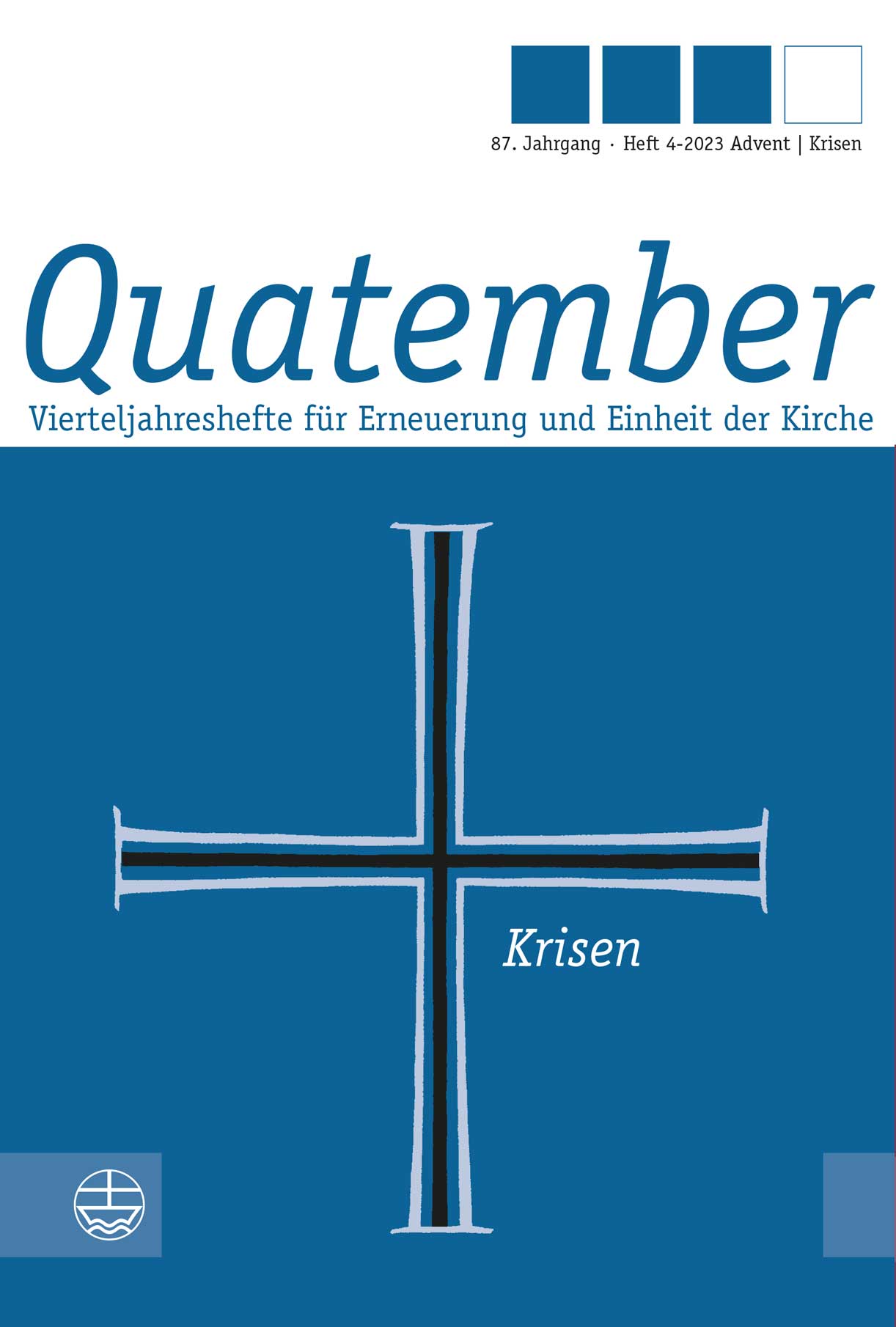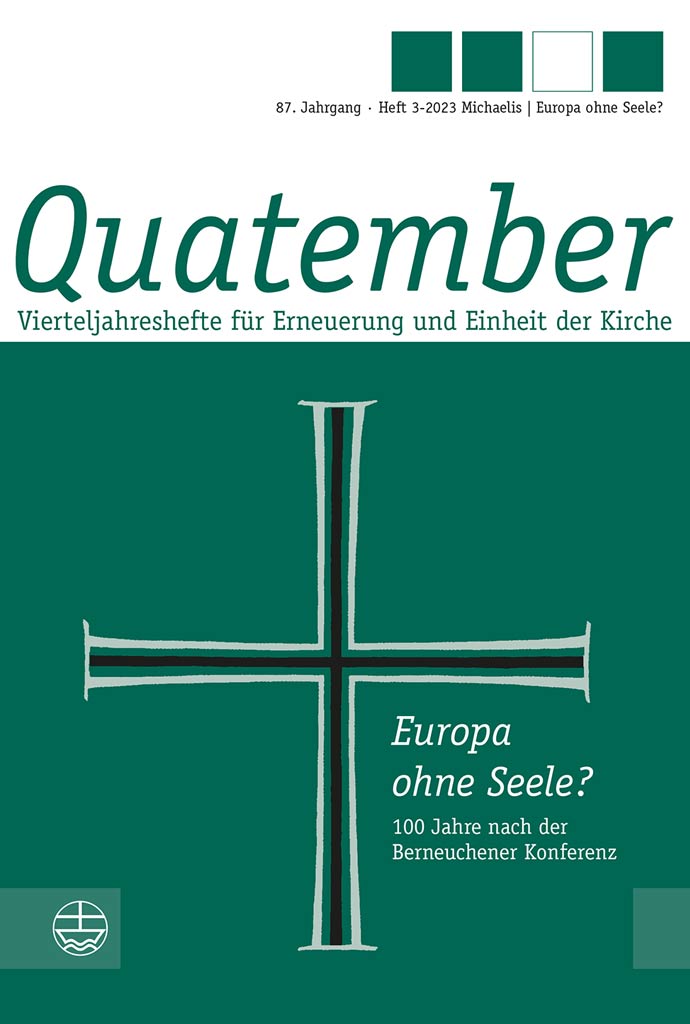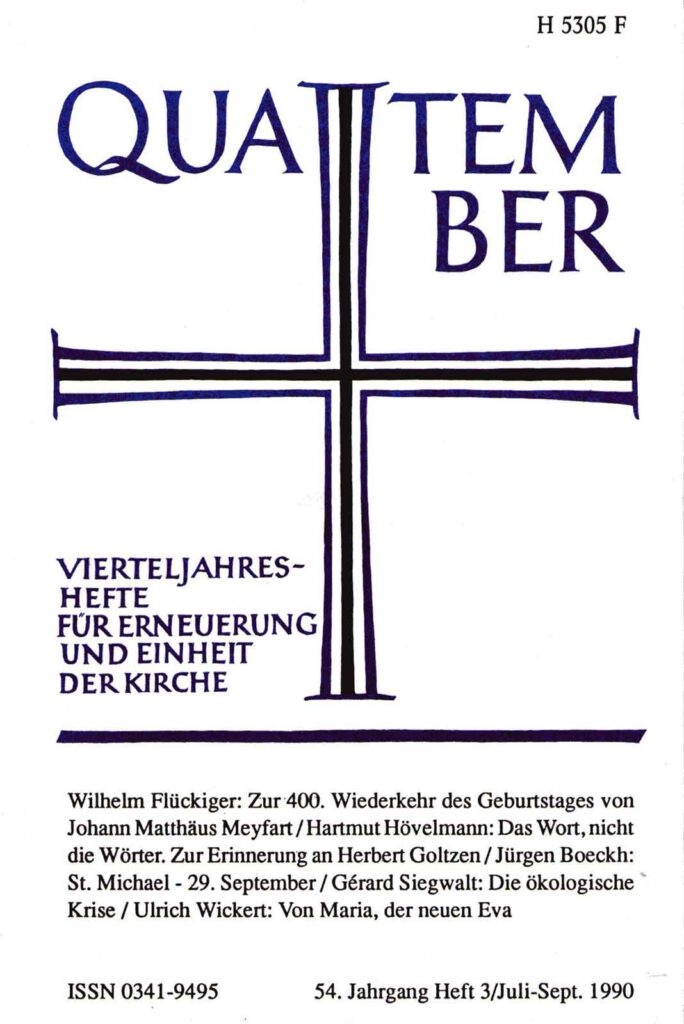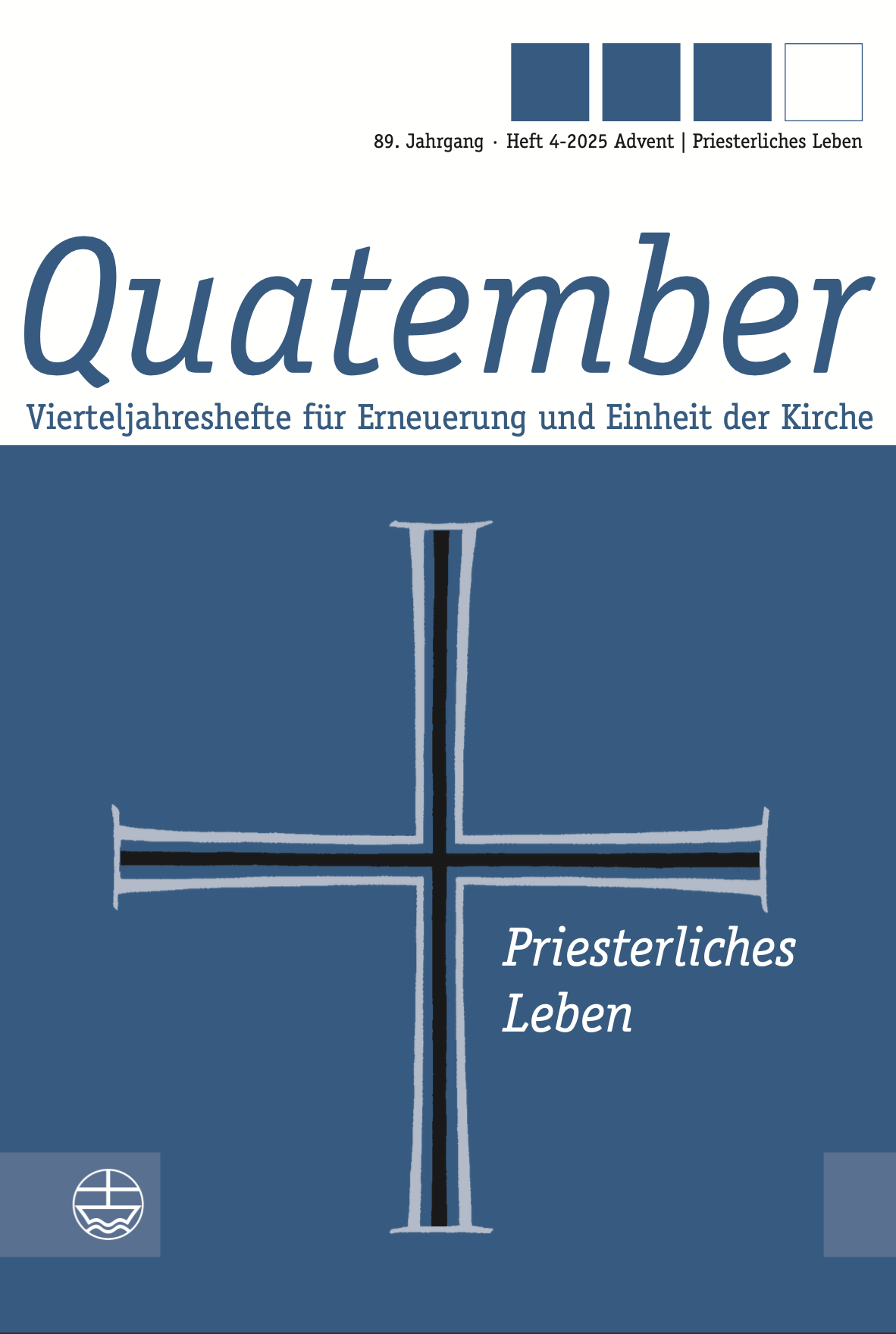
4-2025 | Priesterliches Leben
»Bei der Priesterweihe legen nach dem Bischof alle anwesenden Priester den Kandidaten die Hände auf. […] Sakrament heißt: Ich empfange, was ich mir selbst nicht besorgen kann; ich tue, was nicht aus mir kommt; ich bin Träger dessen, was Gott mir anvertraut hat. Darum kann sich niemand selbst zum Priester erklären; und keine Gemeinde kann mit ihren Beschlüssen jemanden dazu machen. Wir empfangen im Sakrament, was Gott uns schenkt. […] Das Sakrament ist Zeichen der bleibenden Initiative Gottes vor allem menschlichen Handeln und trotz aller menschlichen Schwächen«. (Franz Kamphaus)
Im Sakrament der Priesterweihe sieht Franz Kamphaus die göttliche Beauftragung und Befähigung, die Menschen für ihren Dienst durch Gebet und Handauflegung vermittelt wird. Sie bleiben Menschen und damit fehlbar und dennoch stehen sie in einem Dienst, der die Zuwendung Gottes zu den Menschen und die Hingabe der Menschen an Gott in besonderer Weise ausdrückt. Das wird besonders deutlich in der Feier der Sakramente und dabei zentral in der Eucharistie.
Die Ordination evangelischer Pfarrerinnen und Pfarrer beinhaltet Auftrag und Vollmacht zu Lehre und Sakramentsverwaltung. In der Außenwahrnehmung erscheinen die evangelischen Kirchen aber deutlich mehr als Orte der Lehre und der Seelsorge. Die starke Betonung des Wortes und der Verkündigung – der Dienst der Kirche wird in Nachbarschaftsräumen von »Verkündigungsteams« geleistet – trägt Spuren von intellektualistischer Verengung und moralischer Verflachung. Dem Mysterium bleibt kein Raum, Sakramente führen mancherorts ein Schattendasein.
Georg Bätzing stellt fest: »Dass die evangelische Kirche das sakramentale Amt aufgegeben hat, ist eine der großen Wunden, die das Verhältnis zwischen den beiden großen Konfessionen belasten«. Können wir die priesterliche Dimension des Pfarramtes wieder entdecken?
Dabei ist der Begriff des »Priesterlichen Lebens« nicht allein auf das geistliche Amt in der Kirche zu beschränken. Die Redevom geistlichen Priestertum aller Gläubigen ist keine wohlfeile Ausflucht für eine Reduktion kirchlicher Stellen und die Zusammenlegung von Gemeinden. Ein jeder Christ ist ein priesterlicher Mensch, der Gottes Segen empfängt und ihn weitergeben darf, der so in seinem Lebensumfeld zum Mittler der Liebe Gottes wird. In diesem Empfangen und Weitergeben findet eine Veränderung statt, eine Wandlung des Christen in das Bild Christi (2. Kor. 3,18), im Hören auf das Wort des Evangeliums, genährt von Christus selbst im heiligen Mahl.
In dieser Ausgabe des Quatember stellen sich drei christliche Gemeinschaften vor: Die Priorin der Communität Casteller Ring beschreibt Geschichte und Gegenwart ihrer Gemeinschaft. Irene Schulz stellt uns die Arbeit des Franziskustreffs in Frankfurt vor und Sabine Frank informiert über die Gemeinschaft der Jesus Biker. Ich biete eine Auswahl kirchengeschichtlicher Quellen zum Thema und stelle Altargeräte aus dem Atelier der Töpfermeisterin Rose-Marie Nyqvist vor. Petra Reiz greift noch einmal das Thema der Synode von Nicaea auf.
Im Nachtrag zur letzten Ausgabe des Quatember widmen sich zwei Artikel noch einmal dem Werk von Josua Boesch. Karl Flückiger hat uns Bilder zur Verfügung gestellt, die in einer Beilage farbig erscheinen. Die Bilder des Triptychons von Marzabotto werden in einem von Josua Boesch selbst verfassten Text vorgestellt. Sabine Bayreuther beschreibt die Beziehung des Künstlers zu den Berneuchener Gemeinschaften.
In dieser Ausgabe erscheinen auch wieder drei Predigten. Der Mainzer Domkapitular Prof. Franz-Rudolf Weinert predigte in der Vesper am Ostermontag in der evangelischen Johanneskirche am Tag der Verabschiedung von Pfarrer Volker Truschel. Die anrührende Predigt von Svenja Prust vom Michaelsfest dieses Jahres folgt. Die dritte Predigt stammt von Christiane Gramowski und gehört zum Israelsonntag. Ihre Thematik bleibt in diesem ganzen Jahr aktuell. Es schließen sich Rezensionen an. Damit schließt der Jahrgang des Quatember 2025. Als Schriftleiter wünsche ich eine erfüllte Advents- und Weihnachtszeit und Gottes Segen im Neuen Jahr.
Heiko Wulfert